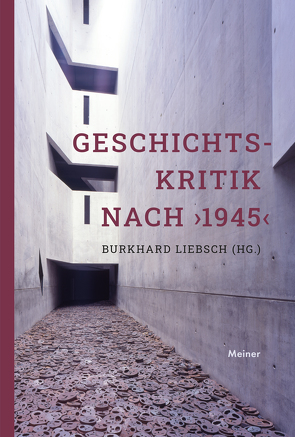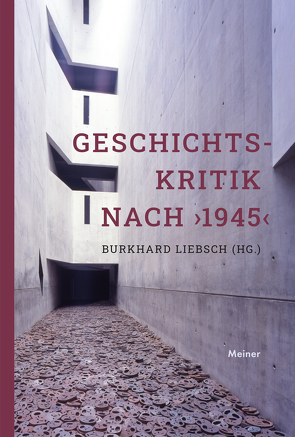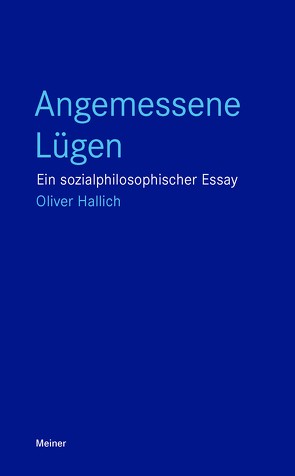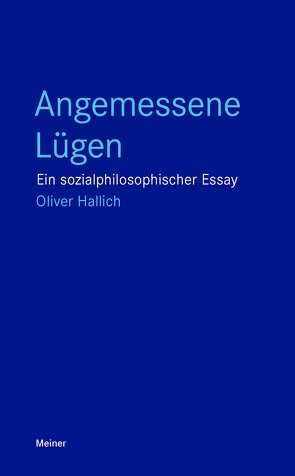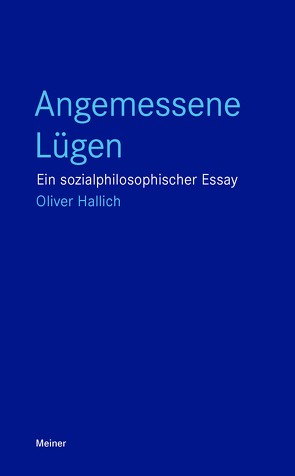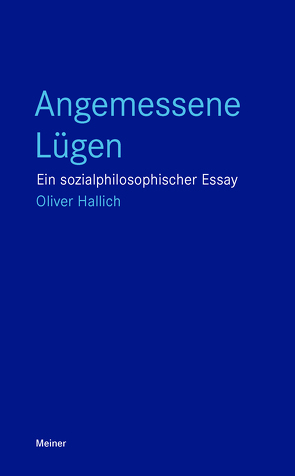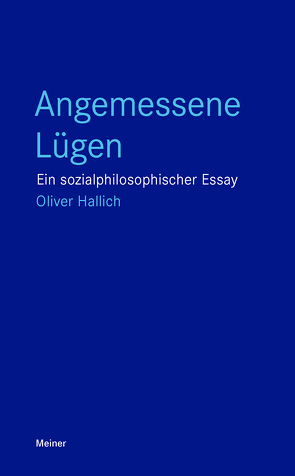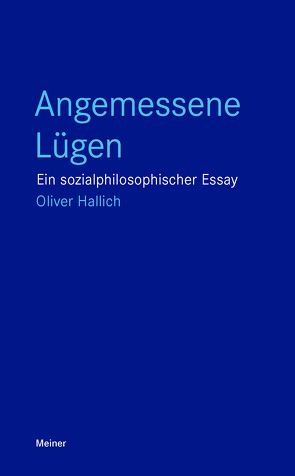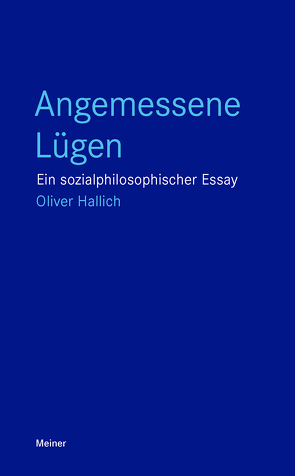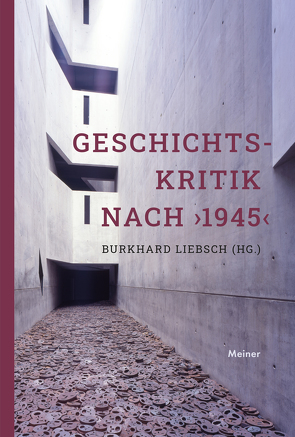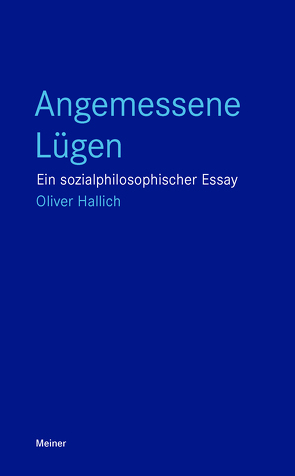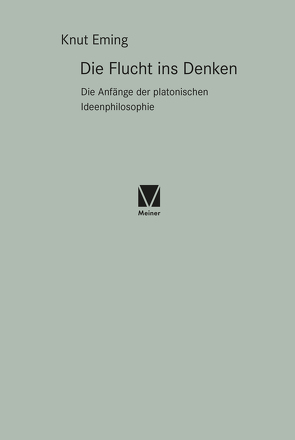Die »Philosophische Bibliothek« (PhB) ist mit ihrer bis ins Jahr 1868 zurückreichenden Geschichte die älteste philosophische Textreihe überhaupt. Heute wie damals sind die grünen Bände ein Begriff für solide, auch für Studenten erschwingliche Textausgaben. Das hier vorgelegte Werk will die »Philosophische Bibliothek« materialiter darstellen, sie aber auch als eigenes philosophie- und buchhistorisches Phänomen beschreiben. Der Band enthält eine Biographie des Begründers und ersten Herausgebers der PhB, des Juristen und Philosophen Julius Hermann von Kirchmann (1802-1884), ebenso wie eine Darstellung der wechselvollen Geschichte der Reihe, die seit ihrer Gründung 1868 fünf Verlage durchlief, bevor sie 1911 von Felix Meiner übernommen und zum Grundstock seines im gleichen Jahre ins Leben gerufenen Verlages wurde.
Die Bibliographie der PhB belegt sodann in einer eigens entwickelten, diplomatischen Beschreibungsart alle von 1868 bis 1985 in dieser Reihe erschienenen 1680 Ausgaben, darunter zahlreiche bisher bibliographisch nicht nachzuweisende Bände.
Dieses mit zahlreichen Abbildungen und das Material erschließenden Registern ausgestattete Buch ist für den Philosophiehistoriker ebenso interessant wie für den Verlags- und Buchgeschichtler oder den praktisch wie wissenschaftlich arbeitenden Bibliothekar.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *

Die »Philosophische Bibliothek« (PhB) ist mit ihrer bis ins Jahr 1868 zurückreichenden Geschichte die älteste philosophische Textreihe überhaupt. Heute wie damals sind die grünen Bände ein Begriff für solide, auch für Studenten erschwingliche Textausgaben. Das hier vorgelegte Werk will die »Philosophische Bibliothek« materialiter darstellen, sie aber auch als eigenes philosophie- und buchhistorisches Phänomen beschreiben. Der Band enthält eine Biographie des Begründers und ersten Herausgebers der PhB, des Juristen und Philosophen Julius Hermann von Kirchmann (1802-1884), ebenso wie eine Darstellung der wechselvollen Geschichte der Reihe, die seit ihrer Gründung 1868 fünf Verlage durchlief, bevor sie 1911 von Felix Meiner übernommen und zum Grundstock seines im gleichen Jahre ins Leben gerufenen Verlages wurde.
Die Bibliographie der PhB belegt sodann in einer eigens entwickelten, diplomatischen Beschreibungsart alle von 1868 bis 1985 in dieser Reihe erschienenen 1680 Ausgaben, darunter zahlreiche bisher bibliographisch nicht nachzuweisende Bände.
Dieses mit zahlreichen Abbildungen und das Material erschließenden Registern ausgestattete Buch ist für den Philosophiehistoriker ebenso interessant wie für den Verlags- und Buchgeschichtler oder den praktisch wie wissenschaftlich arbeitenden Bibliothekar.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *

Die »Philosophische Bibliothek« (PhB) ist mit ihrer bis ins Jahr 1868 zurückreichenden Geschichte die älteste philosophische Textreihe überhaupt. Heute wie damals sind die grünen Bände ein Begriff für solide, auch für Studenten erschwingliche Textausgaben. Das hier vorgelegte Werk will die »Philosophische Bibliothek« materialiter darstellen, sie aber auch als eigenes philosophie- und buchhistorisches Phänomen beschreiben. Der Band enthält eine Biographie des Begründers und ersten Herausgebers der PhB, des Juristen und Philosophen Julius Hermann von Kirchmann (1802-1884), ebenso wie eine Darstellung der wechselvollen Geschichte der Reihe, die seit ihrer Gründung 1868 fünf Verlage durchlief, bevor sie 1911 von Felix Meiner übernommen und zum Grundstock seines im gleichen Jahre ins Leben gerufenen Verlages wurde.
Die Bibliographie der PhB belegt sodann in einer eigens entwickelten, diplomatischen Beschreibungsart alle von 1868 bis 1985 in dieser Reihe erschienenen 1680 Ausgaben, darunter zahlreiche bisher bibliographisch nicht nachzuweisende Bände.
Dieses mit zahlreichen Abbildungen und das Material erschließenden Registern ausgestattete Buch ist für den Philosophiehistoriker ebenso interessant wie für den Verlags- und Buchgeschichtler oder den praktisch wie wissenschaftlich arbeitenden Bibliothekar.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *

Die »Philosophische Bibliothek« (PhB) ist mit ihrer bis ins Jahr 1868 zurückreichenden Geschichte die älteste philosophische Textreihe überhaupt. Heute wie damals sind die grünen Bände ein Begriff für solide, auch für Studenten erschwingliche Textausgaben. - - Das hier vorgelegte Werk will die »Philosophische Bibliothek« materialiter darstellen, sie aber auch als eigenes philosophie- und buchhistorisches Phänomen beschreiben. Der Band enthält eine Biographie des Begründers und ersten Herausgebers der PhB, des Juristen und Philosophen Julius Hermann von Kirchmann (1802-1884), ebenso wie eine Darstellung der wechselvollen Geschichte der Reihe, die seit ihrer Gründung 1868 fünf Verlage durchlief, bevor sie 1911 von Felix Meiner übernommen und zum Grundstock seines im gleichen Jahre ins Leben gerufenen Verlages wurde.
Die Bibliographie der PhB belegt sodann in einer eigens entwickelten, diplomatischen Beschreibungsart alle von 1868 bis 1985 in dieser Reihe erschienenen 1680 Ausgaben, darunter zahlreiche bisher bibliographisch nicht nachzuweisende Bände.
Dieses mit zahlreichen Abbildungen und das Material erschließenden Registern ausgestattete Buch ist für den Philosophiehistoriker ebenso interessant wie für den Verlags- und Buchgeschichtler oder den praktisch wie wissenschaftlich arbeitenden Bibliothekar.
Aktualisiert: 2023-06-23
> findR *

Die »Philosophische Bibliothek« (PhB) ist mit ihrer bis ins Jahr 1868 zurückreichenden Geschichte die älteste philosophische Textreihe überhaupt. Heute wie damals sind die grünen Bände ein Begriff für solide, auch für Studenten erschwingliche Textausgaben. - - Das hier vorgelegte Werk will die »Philosophische Bibliothek« materialiter darstellen, sie aber auch als eigenes philosophie- und buchhistorisches Phänomen beschreiben. Der Band enthält eine Biographie des Begründers und ersten Herausgebers der PhB, des Juristen und Philosophen Julius Hermann von Kirchmann (1802-1884), ebenso wie eine Darstellung der wechselvollen Geschichte der Reihe, die seit ihrer Gründung 1868 fünf Verlage durchlief, bevor sie 1911 von Felix Meiner übernommen und zum Grundstock seines im gleichen Jahre ins Leben gerufenen Verlages wurde.
Die Bibliographie der PhB belegt sodann in einer eigens entwickelten, diplomatischen Beschreibungsart alle von 1868 bis 1985 in dieser Reihe erschienenen 1680 Ausgaben, darunter zahlreiche bisher bibliographisch nicht nachzuweisende Bände.
Dieses mit zahlreichen Abbildungen und das Material erschließenden Registern ausgestattete Buch ist für den Philosophiehistoriker ebenso interessant wie für den Verlags- und Buchgeschichtler oder den praktisch wie wissenschaftlich arbeitenden Bibliothekar.
Aktualisiert: 2023-06-23
> findR *
Hegels »Wissenschaft der Logik« (1812/1816) zählt zu den einflussreichsten philosophischen Schriften der Neuzeit und erhebt den Anspruch einer wissenschaftlichen Darstellung des Systems der reinen Vernunft.
Die drei Teile, »Das Sein«, »Die Lehre vom Wesen« und »Die subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff«, zeichnen den Weg nach, auf dem sich Denken zum begreifenden und sich selbst begreifenden Denken bestimmt. Aufgrund ihres Konzepts einer sich selbst kritisierenden und sich selbst bestimmenden Vernunft gilt die »Wissenschaft der Logik« seit ihrem Erscheinen bis in die Gegenwart hinein als äußerst anspruchsvoller und schwer zu interpretierender Text.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
Hegels »Wissenschaft der Logik« (1812/1816) zählt zu den einflussreichsten philosophischen Schriften der Neuzeit und erhebt den Anspruch einer wissenschaftlichen Darstellung des Systems der reinen Vernunft.
Die drei Teile, »Das Sein«, »Die Lehre vom Wesen« und »Die subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff«, zeichnen den Weg nach, auf dem sich Denken zum begreifenden und sich selbst begreifenden Denken bestimmt. Aufgrund ihres Konzepts einer sich selbst kritisierenden und sich selbst bestimmenden Vernunft gilt die »Wissenschaft der Logik« seit ihrem Erscheinen bis in die Gegenwart hinein als äußerst anspruchsvoller und schwer zu interpretierender Text.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
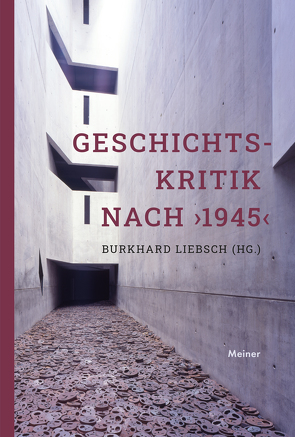
Es steht außer Frage, dass keines der philosophischen Systeme in der Lage gewesen ist, uns »gegen den Schrecken der Geschichte zu verteidigen« (Mircea Eliade). Aber wie sollen wir unser Leben immer noch als geschichtliches begreifen, zumal wenn Geschichte weiterhin exzessiv gewaltförmig vonstattengeht und keinerlei Ausgleich für äußerste Ungerechtigkeit in Aussicht stellt? Bleibt jede(r) sich letztlich selbst überlassen?
Dieses Buch unternimmt eine weit ausholende Bestandsaufnahme wichtiger geschichtskritischer Positionen, die seit 1945 vertreten worden sind; sowohl seitens derer, die ›geschichts-philosophisches‹ Denken für weitgehend obsolet gehalten haben, als auch seitens ihrer Kritiker. Im Zentrum des Interesses steht nicht eine umfassende Historiografie geschichtstheoretischer Diskussionen, sondern die Frage, wie uns die nach 1945 vorgebrachte Geschichtskritik noch heute herausfordert.
Denn die Diskussion darüber, inwiefern das Jahr 1945 eine tiefe Zäsur in der deutschen, europäischen und globalen Geschichte anzeigt, dauert an. Und angesichts einer Renaissance völkischer, antisemitischer, imperialistischer und rassistischer Ideologeme kann man kaum behaupten, sie sei bloß noch von ›historischem‹ Interesse. Weiterhin bleiben wir Menschen rückhaltlos geschichtlicher Gewalt ausgesetzt. Was schützt uns gegen sie?
Mit Beiträgen von Emil Angehrn, Micha Brumlik, Ryan Crawford, Andreas Herberg-Rothe, Stefan-Ludwig Hoffmann, Elisa Klapheck, Wolfgang Knöbl, Gertrud Koch, Katerina u. Martin Koci, Hans-Peter Krüger, Adelheid Kühne, Elad Lapidot, Sandra Lehmann, Michael Mayer, Karl H. Metz, Gabriel Motzkin, Rachel Pafe, Ulrich Plass, Inka Sauter, Jakub Sirovátka, Michael Sonntag, Hasso Spode, Werner Stegmaier, Bernhard H. F. Taureck, Erik Vogt, Liliane M. Weissberg und Annette Wolf.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
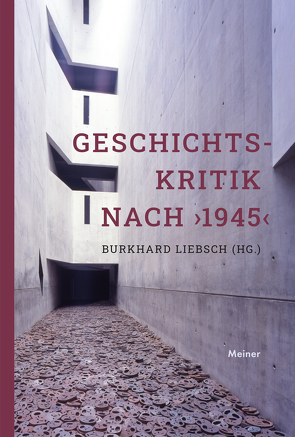
Es steht außer Frage, dass keines der philosophischen Systeme in der Lage gewesen ist, uns »gegen den Schrecken der Geschichte zu verteidigen« (Mircea Eliade). Aber wie sollen wir unser Leben immer noch als geschichtliches begreifen, zumal wenn Geschichte weiterhin exzessiv gewaltförmig vonstattengeht und keinerlei Ausgleich für äußerste Ungerechtigkeit in Aussicht stellt? Bleibt jede(r) sich letztlich selbst überlassen?
Dieses Buch unternimmt eine weit ausholende Bestandsaufnahme wichtiger geschichtskritischer Positionen, die seit 1945 vertreten worden sind; sowohl seitens derer, die ›geschichts-philosophisches‹ Denken für weitgehend obsolet gehalten haben, als auch seitens ihrer Kritiker. Im Zentrum des Interesses steht nicht eine umfassende Historiografie geschichtstheoretischer Diskussionen, sondern die Frage, wie uns die nach 1945 vorgebrachte Geschichtskritik noch heute herausfordert.
Denn die Diskussion darüber, inwiefern das Jahr 1945 eine tiefe Zäsur in der deutschen, europäischen und globalen Geschichte anzeigt, dauert an. Und angesichts einer Renaissance völkischer, antisemitischer, imperialistischer und rassistischer Ideologeme kann man kaum behaupten, sie sei bloß noch von ›historischem‹ Interesse. Weiterhin bleiben wir Menschen rückhaltlos geschichtlicher Gewalt ausgesetzt. Was schützt uns gegen sie?
Mit Beiträgen von Emil Angehrn, Micha Brumlik, Ryan Crawford, Andreas Herberg-Rothe, Stefan-Ludwig Hoffmann, Elisa Klapheck, Wolfgang Knöbl, Gertrud Koch, Katerina u. Martin Koci, Hans-Peter Krüger, Adelheid Kühne, Elad Lapidot, Sandra Lehmann, Michael Mayer, Karl H. Metz, Gabriel Motzkin, Rachel Pafe, Ulrich Plass, Inka Sauter, Jakub Sirovátka, Michael Sonntag, Hasso Spode, Werner Stegmaier, Bernhard H. F. Taureck, Erik Vogt, Liliane M. Weissberg und Annette Wolf.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
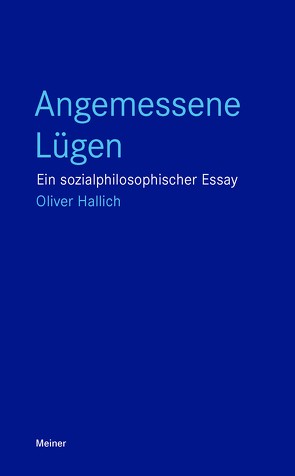
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
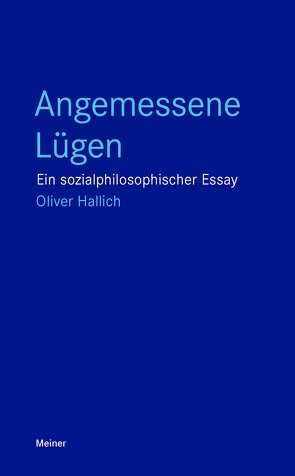
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
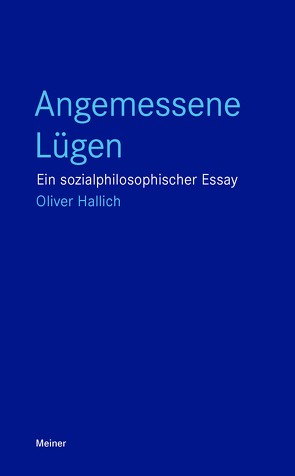
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
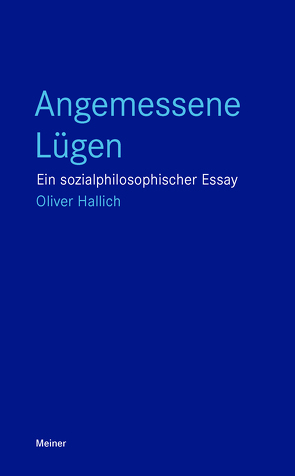
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
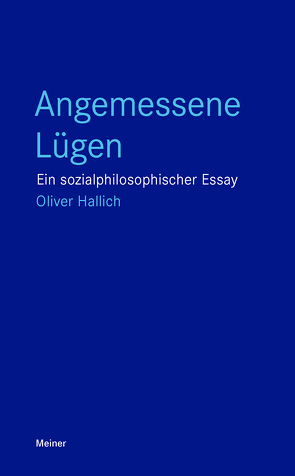
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
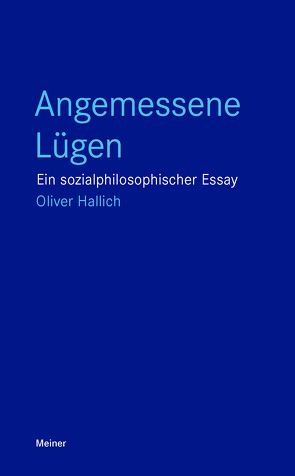
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
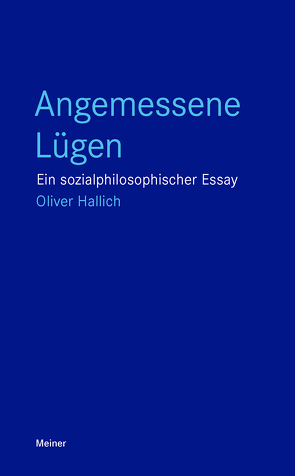
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
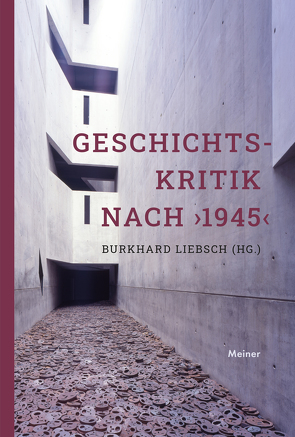
Es steht außer Frage, dass keines der philosophischen Systeme in der Lage gewesen ist, uns »gegen den Schrecken der Geschichte zu verteidigen« (Mircea Eliade). Aber wie sollen wir unser Leben immer noch als geschichtliches begreifen, zumal wenn Geschichte weiterhin exzessiv gewaltförmig vonstattengeht und keinerlei Ausgleich für äußerste Ungerechtigkeit in Aussicht stellt? Bleibt jede(r) sich letztlich selbst überlassen?
Dieses Buch unternimmt eine weit ausholende Bestandsaufnahme wichtiger geschichtskritischer Positionen, die seit 1945 vertreten worden sind; sowohl seitens derer, die ›geschichts-philosophisches‹ Denken für weitgehend obsolet gehalten haben, als auch seitens ihrer Kritiker. Im Zentrum des Interesses steht nicht eine umfassende Historiografie geschichtstheoretischer Diskussionen, sondern die Frage, wie uns die nach 1945 vorgebrachte Geschichtskritik noch heute herausfordert.
Denn die Diskussion darüber, inwiefern das Jahr 1945 eine tiefe Zäsur in der deutschen, europäischen und globalen Geschichte anzeigt, dauert an. Und angesichts einer Renaissance völkischer, antisemitischer, imperialistischer und rassistischer Ideologeme kann man kaum behaupten, sie sei bloß noch von ›historischem‹ Interesse. Weiterhin bleiben wir Menschen rückhaltlos geschichtlicher Gewalt ausgesetzt. Was schützt uns gegen sie?
Mit Beiträgen von Emil Angehrn, Micha Brumlik, Ryan Crawford, Andreas Herberg-Rothe, Stefan-Ludwig Hoffmann, Elisa Klapheck, Wolfgang Knöbl, Gertrud Koch, Katerina u. Martin Koci, Hans-Peter Krüger, Adelheid Kühne, Elad Lapidot, Sandra Lehmann, Michael Mayer, Karl H. Metz, Gabriel Motzkin, Rachel Pafe, Ulrich Plass, Inka Sauter, Jakub Sirovátka, Michael Sonntag, Hasso Spode, Werner Stegmaier, Bernhard H. F. Taureck, Erik Vogt, Liliane M. Weissberg und Annette Wolf.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
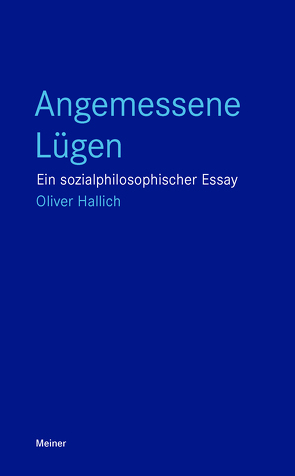
Die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens ist ein Dauerthema der praktischen Philosophie. Seit Platon bemühen sich Philosoph:innen darum zu klären, was Lügen sind und ob – und wenn ja, unter welchen Bedingungen – sie als moralisch erlaubt, möglicherweise sogar moralisch geboten, als moralisch bedenklich, verwerflich oder löblich einzustufen sind und was genau es ist, das sie falsch, verwerflich oder bedenklich macht.
Oliver Hallich plädiert dafür, die Frage nach der moralischen Erlaubtheit des Lügens durch diejenige nach der sozialen Angemessenheit oder Unangemessenheit des Lügens zu ersetzen und sie insofern zu entmoralisieren. Eine Lüge, so die These, ist ein Beziehungsphänomen. Lügen heißt: sozial handeln. Es heißt, sich zum anderen auf eine bestimmte Weise in Beziehung zu setzen. Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer: Wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal, nämlich wenn eine Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, angemessen und manchmal nicht.
Im Ergebnis bezieht Hallich eine auf deontische Kategorien des Verboten- oder Erlaubtseins verzichtende Position, der zufolge Lügen in Abhängigkeit vom sozialen Kontext manchmal als angemessen und manchmal als unangemessen einzustufen sind.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
Mit der analytischen Platon-Deutung ist die Ideenphilosophie erneut ins Zentrum einer logisch-ontologischen Kritik gerückt. Der platonische Standpunkt wird an modernen logischen Standards dargestellt und verständlich gemacht.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
Das Werk des Cusanus gilt als Synthese mittelalterlicher Weisheit und gedanklicher Grundlegung der großen Systeme der beginnenden Renaissance und der neueren Zeit. Dies zeigt sich insbesondere auch in dieser in drei Bücher gegliederten Abhandlung über die Sichtung des Korans von 1460/1461, die die theologische Auseinandersetzung und zugleich Verständigung mit dem Islam zum Thema hat. Die Ausgabe basiert auf der kritischen Erstedition von 1986.
Aktualisiert: 2023-06-24
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Oben: Publikationen von Meiner-- F
Informationen über buch-findr.de: Sie sind auf der Suche nach frischen Ideen, innovativen Arbeitsmaterialien,
Informationen zu Musik und Medien oder spannenden Krimis? Vielleicht finden Sie bei Meiner-- F was Sei suchen.
Neben praxiserprobten Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblättern finden Sie in unserem Verlags-Verzeichnis zahlreiche Ratgeber
und Romane von vielen Verlagen. Bücher machen Spaß, fördern die Fantasie, sind lehrreich oder vermitteln Wissen. Meiner-- F hat vielleicht das passende Buch für Sie.
Weitere Verlage neben Meiner-- F
Im Weiteren finden Sie Publikationen auf band-findr-de auch von folgenden Verlagen und Editionen:
Qualität bei Verlagen wie zum Beispiel bei Meiner-- F
Wie die oben genannten Verlage legt auch Meiner-- F besonderes Augenmerk auf die
inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen.
Für die Nutzer von buch-findr.de:
Sie sind Leseratte oder Erstleser? Benötigen ein Sprachbuch oder möchten die Gedanken bei einem Roman schweifen lassen?
Sie sind musikinteressiert oder suchen ein Kinderbuch? Viele Verlage mit ihren breit aufgestellten Sortimenten bieten für alle Lese- und Hör-Gelegenheiten das richtige Werk. Sie finden neben