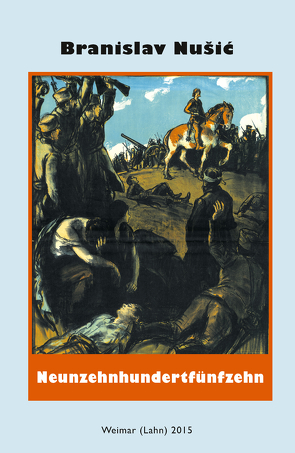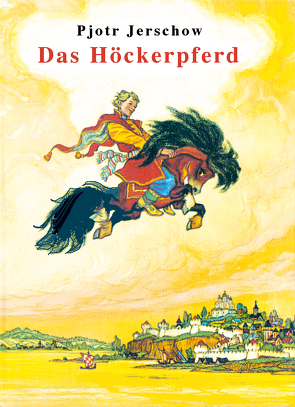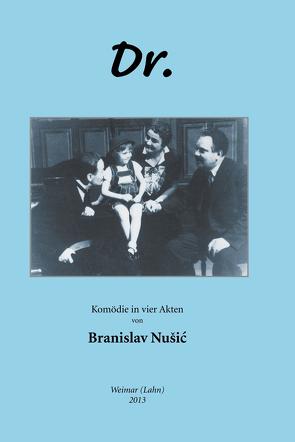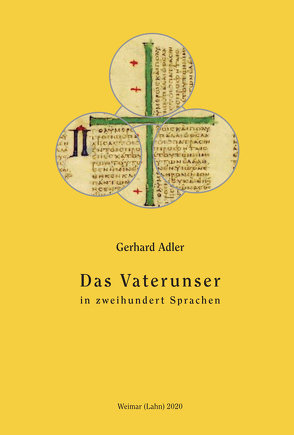Abseits...
Aus dem Nachwort von Bernd E. Scholz
Abseits der Balkanroute, die immer wieder in aller Munde ist, bedeutet, so wie wir es verstehen, hin zu den leisen Stimmen abseits der Lärmpegel der Autobahnen, weit weg also von den oft falschen Propheten – aus Brüssel, Berlin oder Paris, weit weg von den durch sie zubetonierten »paneuropäischen« Korridoren, den mautbewehrten Trassen, und noch weiter weg von den Machinationen der EU-Erweiterungskommissare. Wir selbst befinden uns mit der Ausrichtung auf ein geistiges Erzeugnis jenseits der Routen und Korridore. Unser griechischer ›Diadrom‹ beginnt bei Homer, der mazedonische ›Avtopat‹ bei Kyrill und Method, der serbo-kroatische ›Autoput‹, dieser einstige südslawische Weg »der Brüderlichkeit und Einigkeit« beim Freund der Brüder Grimm, dem Serben Vuk Karadžić, dem Heinrich Heine der Vojvodina Branko Radičević, in dessen Lieblingswald, der Fruška Gora, mich eine kleine Tafel als Studenten 1967 daran erinnerte, wo ich herkam: „Hier erschoss die SS im Sommer 1941... « (Wie oft sollte ich solchen Tafeln noch begegnen.)
Es geht uns um einen begabten jungen mazedonischen Autor, der sich selbst als »lost generation« versteht, und hier insbesondere um seine Kurzprosa. Im zeitgemäßen ›Facebook-Format‹ – maximal bis zu 3600 Zeichen Text... Und ziemlich lange müssen wir dann lesen, bis uns der Erzähler einen konkreten Hinweis gibt, der es uns erlaubt, die Geschehnisse dem Lebensraum des Autors zuzuordnen. Das Erzählte selber ist lokal unbegrenzt – räumlich wie zeitlich.
Mit Kurzprosa begann 1882 schon der junge Anton Tschechow (»Die Kürze ist die Schwester des Talents«, Brief vom 11.April 1889). Bei ihm hieß es noch »Humoreske«, »Kurzgeschichte« – schlecht bezahlt im Feuilleton der Petersburger Tageszeitung »Neue Zeit«, der nichts suspekter war als eben diese neue Zeit. Allgegenwärtig auch hier die politische wie geistliche Zensur, die es mit Humor und der realistischen List der Vernunft zu umgehen galt – jeden Tag von Neuem. Und allgegenwärtig auch hier bereits die Angst vor dem gewaltbereiten Einzeltäter, auch damals bereits Terrorist genannt. Doch kein Terrorist, der von Außen eindringt, sich im Karteisystem des Geheimdienstes erfassen lässt, sondern bei Gjorgjevski ein einfacher und verdienter Bühnenwart im Theater ist es, einer von uns also, der durch seine Tat offen legt, dass ihm die gesellschaftlichen Verhältnisse unerträglich geworden sind. Diese Innensicht aufzudecken, die Triebkräfte darzulegen, die ihn zum mörderischen Handeln drängen, vermag allein die »schöne Literatur«, die »Belletristik«.
Der junge mazedonische Erzähler wird uns zum Vorbild in dieser »Schule des Dialogs der Kulturen«, wie der russische Philosoph Vladimir Bibler sie begründet hat, auf dem Weg zu einem »erkenne Dich selbst«, dieser ureigensten Form geistigen europäischen Seins.
Gehen wir also mitten hinein mit dem ›Kanu des Wortes‹ in die Wildwasser des Balkans, mag er »westlich« sein oder sonst wohin reichen, meinetwegen bis zu den Eskimos nördlich der Sonne ... Denn bis dorthin reicht mittlerweile der scheinbar stumme Menschenzug, der irgendwo von den Wassern des Euphrats aufgebrochen war, um zu retten, was gerade noch zu retten war, das nackte menschliche Leben. Da ist es schon viel, dass es Einer noch schafft, den Dingen einen Namen zu geben, innnerpsychische (Zerfalls-)Prozesse aus ihrer Sprachlosigkeit zu befreien, vor der vermeintlich befreienden Tat mit wenigen zutreffenden Worten die Szenerien zu erhellen und so vielleicht einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, der eigenen Ohnmacht entgegen zu wirken, der sanften Macht des erzählerischen Duktus folgend allgemeinmenschliche, existenzielle Grundsituationen mit den Mitteln erzählerischer Reflexion zu erhellen und somit hartnäckig staatlich und überstaatlich verursachter und bewusst unregulierter Anomie entgegenzuwirken.
Wer einen Titel für ein Buch suchen muss, ist nicht zu beneiden. Sucht er doch etwas, das möglichst in einem Wort das gesamte Buch enthält. Die knappst mögliche Mitteilung für Leser und Öffentlichkeit. Ein weithin hörbares Signal also. Gerne hätten wir daher den Originaltitel übernommen, aber »Nördlich der Sonne« war schon vergeben. Und in Deutschland gilt »Titelschutz«. Außerdem bezieht sich bei uns »nördlich der Sonne« auf Gebiete irgendwo am nördlichen Polarkreis. Da der heute (2016) 30-jährige Erzähler dabei in dieser Erzählung selber den Blick auf seine Heimatstadt Skopje richtet, die in ihrem Landeswappen die Strahlen der Sonne birgt, scheidet »nördlich« also aus. Der mazedonische Leser muss sich hier eher mit landesuntypischen deutschen Lehnwörtern wie »Barock, Schund und Kitsch« anfreunden, die ihm der Erzähler kurz und trocken als charakteristische Merkmale wesentlicher Teile des neuen Skopje vorhält. Kaum wird ihm bewusst sein, dass im November 2013 der »nationale Umbau« seiner Hauptstadt von meinungsbildenden Pressemagazinen mit diesen Ausdrücken belegt worden ist – »Schund, Kitsch« (SPIEGEL, 12.11.2013).
»All diese Orte, die einmal Glück bedeutet haben, sind heute Friedhöfe von Erinnerungen, bedeckt mit düsteren Gespenstern aus Wellblech, verziert mit Staub und bis zur Unkenntlichkeit verändert. Meine Stadt, früher warst Du Liebe, jetzt bist Du nur noch eine Strafe. [...] Ich hätte nie gedacht, dass Du dich statt mit mir jetzt mit Barock, Kitsch und Schund abgeben würdest.« (Hier S. 48)
Und überhaupt: Im Dezember 2013 findet sich der bekannte Altmeister der mazedonischen Literatur, Vlada Urošević, von der umtriebigsten deutschen Literaturkritikerin Elke Schmitter – wieder im SPIEGEL – in diesen »toten Winkel« Europas verbannt (oder vielleicht doch eher aus ihm hervorgeholt?).
Das mochte 2013 noch als ungeschickte Metapher durchgehen – heute nennen wir eine solche Betrachtungsweise »postfaktisch«, was nichts anderes heißen soll als »durch die Tatsachen nicht erhärtet« –, geographisch-politisch betrachtet war es also falsch. Und doch vielsagend. Nach der Zerschlagung Jugoslawiens – diejenigen, die es zerschlagen haben, angeblich um es zu befrieden, sprechen heute lieber von »Zerfall«.
Und ebenfalls heute, am 24.09.2016, fordert ein »Balkangipfel« in Wien »die völlige Schließung der Balkanroute«. Als ob da irgendwo irgendjemand in einem Maut- oder Zollhäuschen säße, der diese Route einfach nach Lust und Laune auf- und zuschließen könnte.
Und hat nicht die Europäische Gemeinschaft genügend investiert, investieren lassen, um diese Route möglichst »barrierefrei« für alle Güter dieser Erde durchgängig zu machen? Von Bergen in Norwegen bis Aleppo in Syrien? Auch an militärischem Einsatz und überquellender Lieferung von kriegerischen Gerätschaften hat es wahrlich nicht gefehlt. Laut einem Beschluss des Deutschen Bundestages im Sommer 2015 wurde das Kosovomandat der Bundeswehr erneuert, das bis dato schon 16 Jahre währte und an die vier Milliarden Euro gekostet haben soll. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Dr. Tobias Lindner, vier Jahre älter als Branislav Gjorgjevski, zeigte sich bei Abgabe seiner JA-Stimme verwundert: »Dieser Bundeswehr-Einsatz dauert fast die Hälfte meines Lebens«. Zu vertieften Einsichten könnte ihm vielleicht ein ›Rollentausch‹ mit Branislav Gjorgjevski verhelfen – Lindner als Beobachter der Bundeswehr, wie sie auf dem größten Truppenübungsplatz des Balkans (Krivolak) im östlichen Teil von Zentralmazedonien und zusammen mit anderen NATO-Truppen Krieg übt – mit einem garantierten mazedonischen Grundeinkommen von 150 Euro (monatlich), und Gjorgjevski als Schriftsteller in Berlin mit dem garantierten Grundeinkommen eines Mitglieds des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags (sechs bis acht tausend Euro monatlich).
Die politbürokratischen Schlagworte zu Mazedonien in deutschsprachigen Medien sind leicht zusammengestellt, ganz zu schweigen von soliden landeskundlichen Daten, jedenfalls solange es noch ein Internet für jedermann gibt, in dem sich diese auffinden lassen. Hier eine Auswahl: gefährliche Sackgasse, autoritäre Halbdemokratie; Medien(un)freiheit in Südosteuropa, Staatskrise, Land in Auflösung, Mafia-Staat, Frontstaat gegen Flüchtlinge, Jugendrevolte, EU- und NATO-Beitritt, Frontex-Einsatz, Balkangipfel, Balkanroute noch dichter machen, Balkanroute nicht dicht machen, lost in Transition, Truppenübungsplatz Krivolak, Rechtsstaatlichkeitsmissionen der Europäischen Union, Eulex, Camp Bondsteel ... ... ...
Der russische Dichter Velimir Chlebnikov hat eine solche Sprache, die überdies durchsetzt ist von zahlreichen Abkürzungen, 1920 als »Vogelsprache« bezeichnet.
Mazedonien, seit 1991 unabhängig, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia, EJRM (Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien), ein Land von der Größe des Bundeslandes Hessen, hat »eine der schwächsten Volkswirtschaften Europas und befindet sich in einem Transformierungsprozess, sowohl wirtschaftlich als auch politisch« (de.wikipedia). Bei Gjorgjevski wird klinisch-konkret wie übertragend aus der Transformation des alten in den neuen ›homo oeconomicus Europeanus‹ etwas Toxisch-Lethales: »Es ist ein schwerer Asbest hier«.
Das Sinnbild menschlicher Existenz in postnuklearer Erdenendzeit ist der Stalker in dem gleichnamigen Film des russischen Regisseurs Andrej Tarkovskij (1978/79). Der Stalker ist jemand, der sich seinen Weg durch unbewohnbare, das heißt für die Dauer der Menschheitsgeschichte nicht wiederbelebbare »Zonen« hindurch zu ertasten sucht. Jemand, der »Abseits« des Unbelebbaren vielleicht auch irgendwo und irgendwie »dazwischen« umherirrt, ohne Aussicht wie bei Gjorgjevski auf einen »Silbersee«, dessen seltsame Algen den Tod vom Schreibenden nur fernhalten, solange er am See verweilt, der aber sterben muss, sobald er sich von ihm entfernt.
Die selbst geschaffenen »Fegefeuer« der Menschheit sind vielfältig und unabsehbar.
Der existenzielle Ausgangspunkt des heute (2016) Dreißigjährigen ist seine nach dem Jugoslawienkrieg seiner Kindheitsjahre (die 1990-er Jahre) mit Nuklearstaub von abgereicherten Uran belastete Heimaterde. Erzählend wehrt er sich dagegen, dass aus seiner Generation eine Generation von Stalkern wird, für die er das Epitaph im Frühjahr 2015 eigentlich schon geschrieben hatte.
»Meine Generation, in der zweiten Hälfte der 80-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts (1985-90) geboren. Menschen, geboren vielleicht in der progressivsten Periode, unmittelbar vor dem Zerfall der ehemaligen Föderation. Eine Generation, die im Sozialismus geboren, in der Übergangsphase erzogen wurde und im Kapitalismus funktionieren sollte. Im Unterschied zu den vorhergehenden war meine Generation zu jung, um die Schrecken der gesellschaftlichen Reformierung zu erfassen, doch zugleich vollkommen bereit, sich auf diese ganze technologische Blüte einzulassen. Wir sollten eine Generation sein, die eine neue Welle von Ideen mit sich brachte, völlig im Einklang mit den zeitgenössischen westlichen Werten. Doch stattdessen hat meine Generation ihre Fähigkeiten auf die Bedürfnisse der westlichen Zivilisation abgestimmt. Im Westen und nicht hier, versteht sich. Meine Generation ist heute von Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit okkupiert. Meine Generation tut heute alles, außer an einer besseren Zukunft zu bauen. Meine Generation arbeitet heute auf Schiffen, in McDonalds-Filialen, wechselt As-besttafeln aus und legt Fliesen auf jedem Meridian von hier bis Kalifornien. Es gibt auch solche, die an angesehenen höheren Bildungsinstitutionen lehren und verantwortliche Aufgaben in renommierten Einrichtungen wahrnehmen. Hier, in dieser unserer Heimat, lebt meine Generation auf Sparflamme. Sie verbraucht ihre Leben von heute auf morgen. Sie träumt von besseren Tagen, während sie darauf wartet, dass ihr jemand einen Brosamen zuwirft, von dem dieser jemand denkt, dass er ausreichend sei. Sie träumt von einer festen Arbeitsstelle, während sie das Antragsformular für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in irgendeinem anderen Land ausfüllt. [...] Als ich in diesen Tagen die besetzten Fakultäten besuchte, sah ich eine Generation oder wenigstens einen soliden Teil einer Generation, die nicht unter den Umständen leben will, die meine Generation zugelassen hat. Ich sah eine Generation, der das Sicheinsetzen für das eigene Land wichtiger ist als Green Cards und Auswanderungsvisa. [...] Mögen diese Menschen nach uns das zurückerobern, was uns nicht zu verteidigen gelungen ist. Mögen sie Wissen und Werte okkupieren, anstatt es zuzulassen, dass sie selbst von Mittelmäßigkeit und Maulheldentum okkupiert werden.« (Aus dem Mazedonischen von Erika Beermann, »Die okkupierte Generation«, gjorgjevski.blogspot.de)
23 Kurzgeschichten abseits der Balkanroute also, doch sie treffen mitten hinein ins Herz Europas.