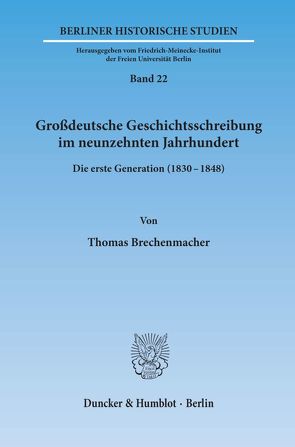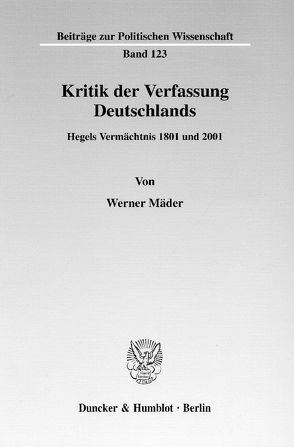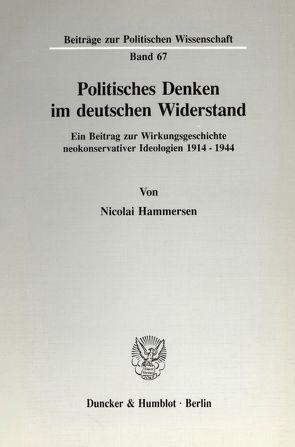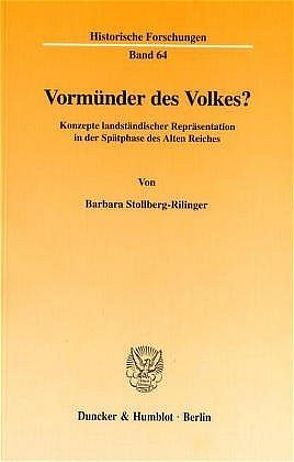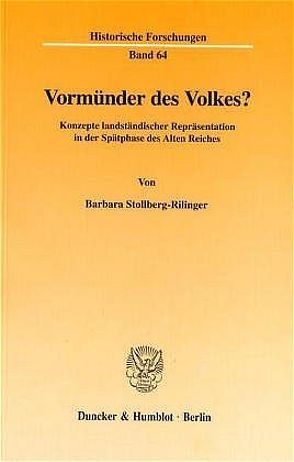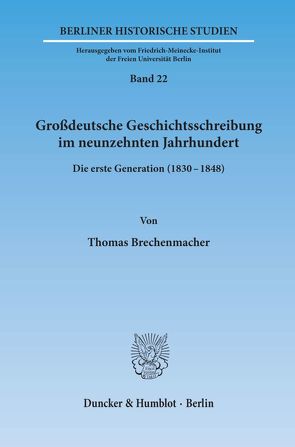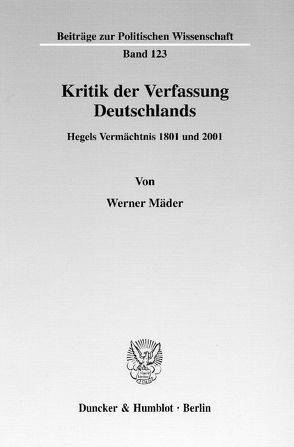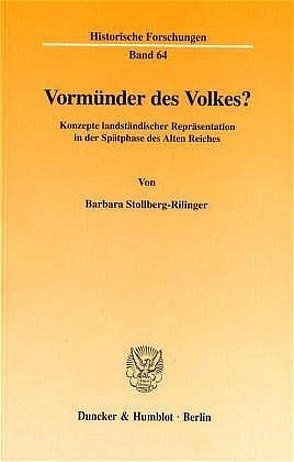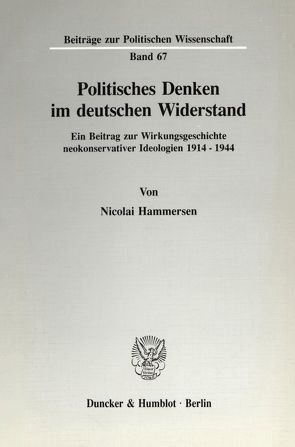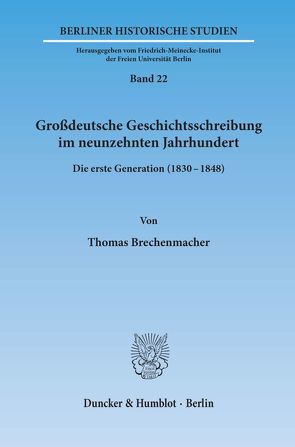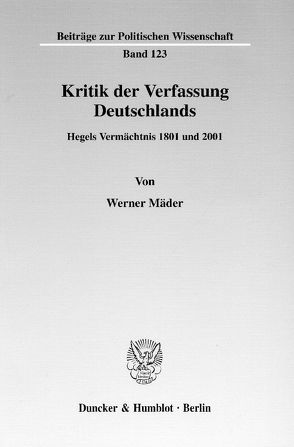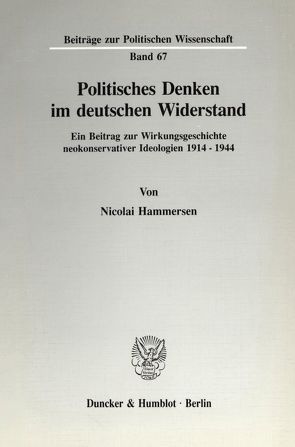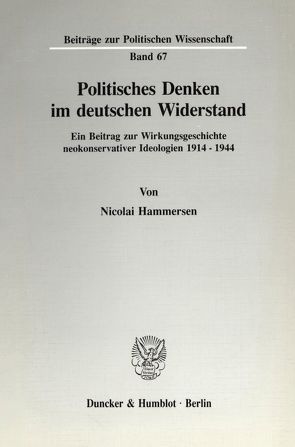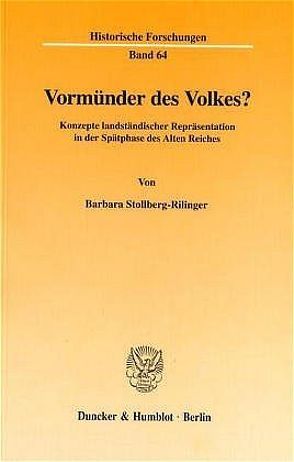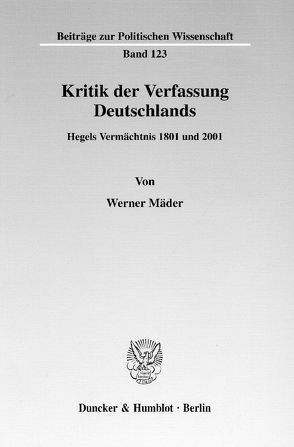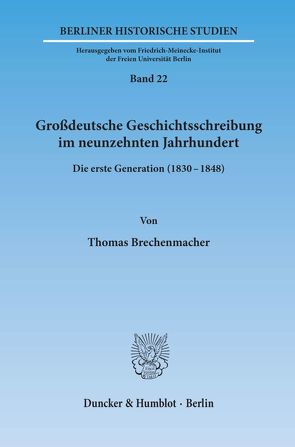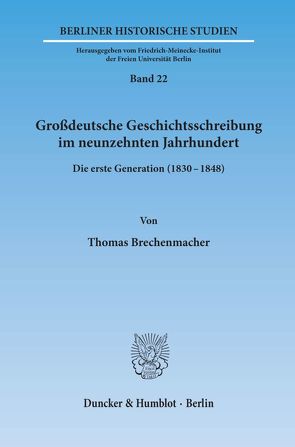
Großdeutsche Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert: damit sind die vielfältig ausgeprägten Ansätze vor allem konservativer, dem Katholizismus nahestehender Historiker bezeichnet, der dominanten borussianischen Geschichtsdeutung entgegenzutreten. Wollte diese die Notwendigkeit eines kleindeutschen Nationalstaates unter preußischer Führung aus dem Verlauf der deutschen Geschichte ableiten, erscheint als Hauptcharakteristikum der großdeutschen Alternative das Bestreben, eine staatliche Neuordnung nicht unter Verzicht auf einen Teil Deutschlands zuzugeben, der dessen Geschicke über viele Jahrhunderte hinweg so maßgeblich bestimmte. Aber nicht nur der Hinweis auf die Rolle Österreichs steht im Zentrum der großdeutschen Geschichtsbilder, sondern der Versuch einer angemesseneren Würdigung der gesamten Reichsgeschichte mit ihren gewachsenen Ordnungen und Traditionen, von den Ottonen bis zum Ende von 1806.
Die Geschichte der großdeutschen Historiographie im 19. Jahrhundert beabsichtigt, eine Erinnerungslücke innerhalb der Geschichte des Faches zu schließen. Sie legt dar, warum diese Historiographie für ihre Zeit bedeutend war, worin ihre Leistungen, worin ihre Irrtümer lagen, sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Kenntnis und Erkenntnis deutscher Geschichte als auch hinsichtlich der Ausbildung der wissenschaftlichen Disziplin "Geschichte". Die vorliegende Arbeit entwickelt hierfür zunächst ein weites Konzept, das nicht nur die Jahre der tagespolitischen Aktualität des Großdeutsch-Kleindeutsch-Gegensatzes zwischen 1848/49 und 1866/71 umgreift, sondern über drei Historikergenerationen hinweg die Zeit der eigentlichen Entstehung großdeutscher Geschichtsschreibung seit etwa 1830 ebenso mit einbezieht wie deren Weiter- und Umbildung in den Jahren nach der Reichsgründung, bis ins 20. Jahrhundert hinein (Einleitung). Der anschließend ausgeführte, in sich geschlossene erste Teil dieses Konzepts behandelt dann anhand der Werke sowie anhand von Korrespondenzen und unveröffentlichtem Nachlaßmaterial die Grundlegungen und Anfänge großdeutscher Historiographie zwischen 1830 und 1848 am Beispiel fünf ausgewählter Historiker der "ersten Generation": Johann Friedrich Böhmer, Friedrich Emanuel Hurter, August Friedrich Gfrörer, Ignaz Döllinger und Constantin Höfler.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
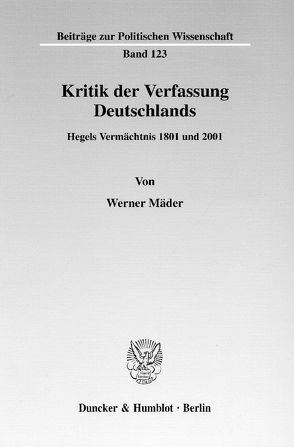
Integration und Desintegration sind ein zentrales Thema der Geisteswissenschaften. Auf makropolitischer Ebene gilt das besondere Interesse dem Entstehen und Vergehen von Staaten, entscheiden sich doch hiermit existenzielle Fragen des Seins einer politischen Gemeinschaft. Auf mikropolitischer Ebene geht es um die Frage, inwieweit dem Bürger "aufgegeben" ist, sich in Gesellschaft und Staat zu integrieren. Supranationalisierung und Globalisierung lassen die Kraft des Nationalstaates schwinden. Dem Übergang der Moderne in die Postmoderne entspricht der Übergang von der Welt der Staaten mit ihren durch Grenzen abgeschlossenen Territorien zur Welt der Kontinente, Gemeinschaften und Netzwerke. Doch gibt es viele Stimmen, die meinen, der Staat sei auf absehbare Zeit nicht wegzudenken und als politische Gemeinschaft zu schützen.
Werner Mäder ist anderer Auffassung: "Deutschland ist kein Staat mehr ..." lautet sein Befund. Der Autor zieht Parallelen zu Hegels Schrift "Kritik der Verfassung Deutschlands" aus dem Jahre 1801 und seinen Kriterien des Staates. Nach Mäder ist das Grundgesetz nur noch eine "Gedankenverfassung", seine fundamentalen Voraussetzungen Staat, Souveränität, Nation, Volk und Demokratie substanziell ausgezehrt. Für Europa bedeutet dies, sich mit eigener Identität selbst zu behaupten, um den Souveränitätsverlust seiner Länder auszugleichen und auf eine neue Multipolarität der internationalen Beziehungen hinzuarbeiten.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
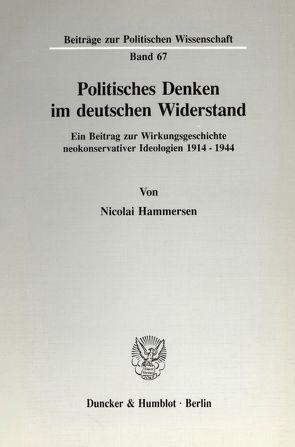
Eine Auseinandersetzung mit den politisch-historischen Wurzeln des deutschen Widerstandes wie auch seine geistesgeschichtliche Einordnung haben bislang noch nicht stattgefunden. Daß die Opposition gegen Hitler der neukonservativen Publizistik der Weimarer Republik nahegestanden und Ideen ihrer Kritiker fortgeführt hat, darauf ist hier und da hingewiesen worden. Die systematische Überprüfung legt eine deutliche Wesensverwandtschaft offen. Worin diese Verwandtschaft im einzelnen besteht, versucht die Untersuchung mit Blick auf den Fundus politischer Ordnungs- und Wertvorstellungen zu zeigen, aus dem die Widerstandskämpfer offensichtlich geschöpft haben. In der Nachfolge der »Ideen von 1914« richtet sich das Augenmerk dabei vor allem auf die Adepten des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. Die Quellen belegen eindrucksvoll die Anknüpfung des politischen Denkens in der nationalkonservativen Opposition an neokonservative Begriffe und Ideologien, in deren Genealogie man viele ihrer Mitglieder verzeichnen kann. Sie haben im großen und ganzen den »geistigkulturellen deutschen Sonderweg« (Nipperdey) nicht überwunden, sondern fortgesetzt.
Mit dem Versuch, den historischen Ort des deutschen Widerstandes in der (geistes-)geschichtlichen Kontinuität konservativen Denkens aufzuzeigen, wird das Verständnis seiner politischen Vorstellungswelt erst möglich und einer adäquaten Beurteilung unter Berücksichtigung der Zeitverhaftung politischen Denkens der Weg geebnet. Das Bedürfnis nach »kritischen Gutachten zur Geschichte« wird dabei nicht befriedigt. Es geht nicht darum, dem Widerstand Fortschrittlichkeit oder eine reaktionäre Einstehung bescheinigen zu wollen, sondern darum, der historischen Wirklichkeit gerecht zu werden, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dies wird durch ein teilnehmendes Interesse gewährleistet, das sich dem Versuch versagt, mit dem erhobenen Zeigefinger des Nachgeborenen darüber zu rechten, welches die guten und welches die bösen, die richtigen und die falschen politischen Ideen sind. Der rückschauende Betrachter nimmt weder den Blickwinkel demokratischer Nachkriegswirklichkeit ein, noch setzt er die gegenwärtige politische Kultur anderen Zeiten und Menschen zum Maß. Er möchte vielmehr zeigen, wie es eigentlich gewesen, und nicht, was sich eigentlich hätte ereignen sollen.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
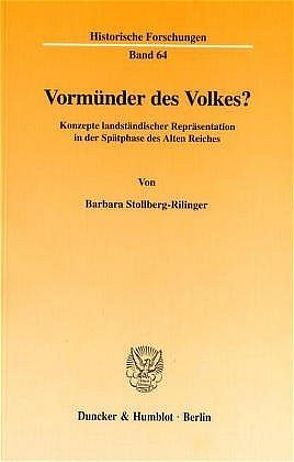
Die landständischen Verfassungen in den Territorien des frühneuzeitlichen Reiches sind von der historischen Forschung gern als Vorläufer des modernen Parlamentarismus aufgefaßt worden. Diese Deutung war von dem Bemühen um demokratisch-rechtsstaatliche Traditionsstiftung geleitet; für sie schien zu sprechen, daß die vormodernen Landstände schon von den Zeitgenossen als »Repräsentanten der Untertanen« bezeichnet worden waren. Im Gegensatz zu dieser älteren Auffassung wird hier die These vertreten, daß ein begrifflicher Bruch das ältere Verständnis ständischer Repräsentation von dem des 19. und 20. Jahrhunderts trennt - ein revolutionärer Bruch, den man allerdings schon im frühen 19. Jh. zu verschleiern oder zu überbrücken suchte, indem man die eigenen Reformforderungen mit der Legitimität eines unvordenklichen Alters versah. Die Verfassungsdebatte der Revolutionszeit wurde vielfach als historische Debatte um Ursprung, Alter und wahres Wesen der landständischen Verfassungen geführt. Die Entwicklung der Geschichtsschreibung über die Landstände seit dem frühen 19. Jahrhundert ist nicht losgelöst von diesen verfassungspolitischen Umständen ihrer Entstehungszeit zu begreifen. Die Rekonstruktion dieser Zusammenhänge ist daher unter anderem als Beitrag zur Selbstreflexion der historiographischen Begrifflichkeit zu verstehen.
Anhand der Verwendung des Repräsentationsbegriffs seit dem 17. Jh. läßt sich nachzeichnen, wie das traditionelle herrschaftsständisch-korporative Prinzip politischer Partizipation allmählich ausgehöhlt wurde. Im Gehäuse der hergebrachten Formen machten sich neue Inhalte breit. Die Staatsrechtler meinten mit landständischer Repräsentation bis weit ins 18. Jh. noch vor allem, daß den Ständen die Kompetenz zukomme, ihr korporatives Handeln der Gesamtheit der Untertanen - unabhängig von deren Willen - verbindlich zuzurechnen und sie darauf zu verpflichten. Gegen Ende des 18. Jhs. wurde dieses Verhältnis von Grund und Folge im Vorgang der Repräsentation umgekehrt: Nun meinte man mit landständischer Repräsentation, daß die Stände vom Volk abgeleitete Rechte ausübten und dem Willen des Volkes Ausdruck verliehen oder doch verleihen sollten. Ging es bei dem älteren Repräsentationsbegriff um die korporative Handlungsfähigkeit der Stände selbst, so postulierte der neue die politische Handlungsfähigkeit der nicht-privilegierten Untertanen. Die Tatsache, daß die Landstände dem neuen Anspruch aufgrund ihrer Struktur kaum entsprechen konnten, wurde nun zum Ansatzpunkt der Kritik und führte zu Reformvorschlägen, die die herrschaftlich-korporative Struktur der Landstände mehr oder weniger offen in Frage stellten. Die Französische Revolution löste in verschiedenen Territorien eine Welle neuer Partizipationsforderungen aus. Sie legte zum einen das Legitimationsdefizit der Landstände bloß, machte die traditionellen Landtage aber zum anderen zum Gegenstand aktueller Reformhoffnungen. Am Beispiel der Konflikte in einzelnen Territorien zeigt sich indessen, daß die Landtage im Rahmen der Reichsverfassung aus sich selbst heraus kaum reformfähig waren.
Aktualisiert: 2023-06-15
> findR *
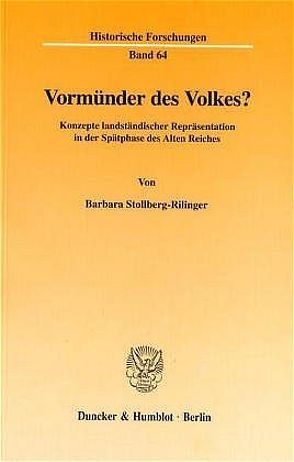
Die landständischen Verfassungen in den Territorien des frühneuzeitlichen Reiches sind von der historischen Forschung gern als Vorläufer des modernen Parlamentarismus aufgefaßt worden. Diese Deutung war von dem Bemühen um demokratisch-rechtsstaatliche Traditionsstiftung geleitet; für sie schien zu sprechen, daß die vormodernen Landstände schon von den Zeitgenossen als »Repräsentanten der Untertanen« bezeichnet worden waren. Im Gegensatz zu dieser älteren Auffassung wird hier die These vertreten, daß ein begrifflicher Bruch das ältere Verständnis ständischer Repräsentation von dem des 19. und 20. Jahrhunderts trennt - ein revolutionärer Bruch, den man allerdings schon im frühen 19. Jh. zu verschleiern oder zu überbrücken suchte, indem man die eigenen Reformforderungen mit der Legitimität eines unvordenklichen Alters versah. Die Verfassungsdebatte der Revolutionszeit wurde vielfach als historische Debatte um Ursprung, Alter und wahres Wesen der landständischen Verfassungen geführt. Die Entwicklung der Geschichtsschreibung über die Landstände seit dem frühen 19. Jahrhundert ist nicht losgelöst von diesen verfassungspolitischen Umständen ihrer Entstehungszeit zu begreifen. Die Rekonstruktion dieser Zusammenhänge ist daher unter anderem als Beitrag zur Selbstreflexion der historiographischen Begrifflichkeit zu verstehen.
Anhand der Verwendung des Repräsentationsbegriffs seit dem 17. Jh. läßt sich nachzeichnen, wie das traditionelle herrschaftsständisch-korporative Prinzip politischer Partizipation allmählich ausgehöhlt wurde. Im Gehäuse der hergebrachten Formen machten sich neue Inhalte breit. Die Staatsrechtler meinten mit landständischer Repräsentation bis weit ins 18. Jh. noch vor allem, daß den Ständen die Kompetenz zukomme, ihr korporatives Handeln der Gesamtheit der Untertanen - unabhängig von deren Willen - verbindlich zuzurechnen und sie darauf zu verpflichten. Gegen Ende des 18. Jhs. wurde dieses Verhältnis von Grund und Folge im Vorgang der Repräsentation umgekehrt: Nun meinte man mit landständischer Repräsentation, daß die Stände vom Volk abgeleitete Rechte ausübten und dem Willen des Volkes Ausdruck verliehen oder doch verleihen sollten. Ging es bei dem älteren Repräsentationsbegriff um die korporative Handlungsfähigkeit der Stände selbst, so postulierte der neue die politische Handlungsfähigkeit der nicht-privilegierten Untertanen. Die Tatsache, daß die Landstände dem neuen Anspruch aufgrund ihrer Struktur kaum entsprechen konnten, wurde nun zum Ansatzpunkt der Kritik und führte zu Reformvorschlägen, die die herrschaftlich-korporative Struktur der Landstände mehr oder weniger offen in Frage stellten. Die Französische Revolution löste in verschiedenen Territorien eine Welle neuer Partizipationsforderungen aus. Sie legte zum einen das Legitimationsdefizit der Landstände bloß, machte die traditionellen Landtage aber zum anderen zum Gegenstand aktueller Reformhoffnungen. Am Beispiel der Konflikte in einzelnen Territorien zeigt sich indessen, daß die Landtage im Rahmen der Reichsverfassung aus sich selbst heraus kaum reformfähig waren.
Aktualisiert: 2023-05-25
> findR *
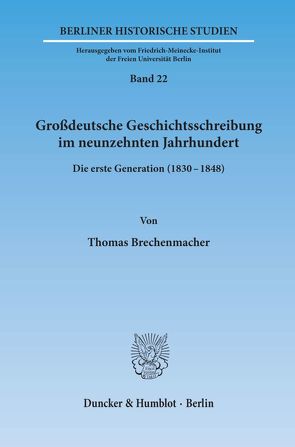
Großdeutsche Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert: damit sind die vielfältig ausgeprägten Ansätze vor allem konservativer, dem Katholizismus nahestehender Historiker bezeichnet, der dominanten borussianischen Geschichtsdeutung entgegenzutreten. Wollte diese die Notwendigkeit eines kleindeutschen Nationalstaates unter preußischer Führung aus dem Verlauf der deutschen Geschichte ableiten, erscheint als Hauptcharakteristikum der großdeutschen Alternative das Bestreben, eine staatliche Neuordnung nicht unter Verzicht auf einen Teil Deutschlands zuzugeben, der dessen Geschicke über viele Jahrhunderte hinweg so maßgeblich bestimmte. Aber nicht nur der Hinweis auf die Rolle Österreichs steht im Zentrum der großdeutschen Geschichtsbilder, sondern der Versuch einer angemesseneren Würdigung der gesamten Reichsgeschichte mit ihren gewachsenen Ordnungen und Traditionen, von den Ottonen bis zum Ende von 1806.
Die Geschichte der großdeutschen Historiographie im 19. Jahrhundert beabsichtigt, eine Erinnerungslücke innerhalb der Geschichte des Faches zu schließen. Sie legt dar, warum diese Historiographie für ihre Zeit bedeutend war, worin ihre Leistungen, worin ihre Irrtümer lagen, sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Kenntnis und Erkenntnis deutscher Geschichte als auch hinsichtlich der Ausbildung der wissenschaftlichen Disziplin "Geschichte". Die vorliegende Arbeit entwickelt hierfür zunächst ein weites Konzept, das nicht nur die Jahre der tagespolitischen Aktualität des Großdeutsch-Kleindeutsch-Gegensatzes zwischen 1848/49 und 1866/71 umgreift, sondern über drei Historikergenerationen hinweg die Zeit der eigentlichen Entstehung großdeutscher Geschichtsschreibung seit etwa 1830 ebenso mit einbezieht wie deren Weiter- und Umbildung in den Jahren nach der Reichsgründung, bis ins 20. Jahrhundert hinein (Einleitung). Der anschließend ausgeführte, in sich geschlossene erste Teil dieses Konzepts behandelt dann anhand der Werke sowie anhand von Korrespondenzen und unveröffentlichtem Nachlaßmaterial die Grundlegungen und Anfänge großdeutscher Historiographie zwischen 1830 und 1848 am Beispiel fünf ausgewählter Historiker der "ersten Generation": Johann Friedrich Böhmer, Friedrich Emanuel Hurter, August Friedrich Gfrörer, Ignaz Döllinger und Constantin Höfler.
Aktualisiert: 2023-05-20
> findR *
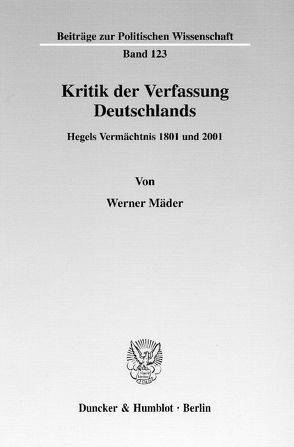
Integration und Desintegration sind ein zentrales Thema der Geisteswissenschaften. Auf makropolitischer Ebene gilt das besondere Interesse dem Entstehen und Vergehen von Staaten, entscheiden sich doch hiermit existenzielle Fragen des Seins einer politischen Gemeinschaft. Auf mikropolitischer Ebene geht es um die Frage, inwieweit dem Bürger "aufgegeben" ist, sich in Gesellschaft und Staat zu integrieren. Supranationalisierung und Globalisierung lassen die Kraft des Nationalstaates schwinden. Dem Übergang der Moderne in die Postmoderne entspricht der Übergang von der Welt der Staaten mit ihren durch Grenzen abgeschlossenen Territorien zur Welt der Kontinente, Gemeinschaften und Netzwerke. Doch gibt es viele Stimmen, die meinen, der Staat sei auf absehbare Zeit nicht wegzudenken und als politische Gemeinschaft zu schützen.
Werner Mäder ist anderer Auffassung: "Deutschland ist kein Staat mehr ..." lautet sein Befund. Der Autor zieht Parallelen zu Hegels Schrift "Kritik der Verfassung Deutschlands" aus dem Jahre 1801 und seinen Kriterien des Staates. Nach Mäder ist das Grundgesetz nur noch eine "Gedankenverfassung", seine fundamentalen Voraussetzungen Staat, Souveränität, Nation, Volk und Demokratie substanziell ausgezehrt. Für Europa bedeutet dies, sich mit eigener Identität selbst zu behaupten, um den Souveränitätsverlust seiner Länder auszugleichen und auf eine neue Multipolarität der internationalen Beziehungen hinzuarbeiten.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
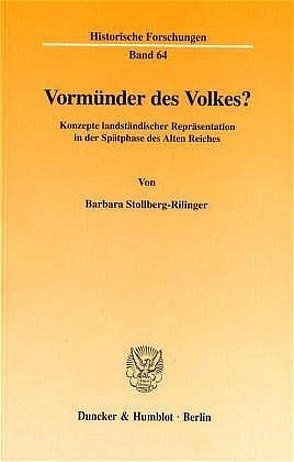
Die landständischen Verfassungen in den Territorien des frühneuzeitlichen Reiches sind von der historischen Forschung gern als Vorläufer des modernen Parlamentarismus aufgefaßt worden. Diese Deutung war von dem Bemühen um demokratisch-rechtsstaatliche Traditionsstiftung geleitet; für sie schien zu sprechen, daß die vormodernen Landstände schon von den Zeitgenossen als »Repräsentanten der Untertanen« bezeichnet worden waren. Im Gegensatz zu dieser älteren Auffassung wird hier die These vertreten, daß ein begrifflicher Bruch das ältere Verständnis ständischer Repräsentation von dem des 19. und 20. Jahrhunderts trennt - ein revolutionärer Bruch, den man allerdings schon im frühen 19. Jh. zu verschleiern oder zu überbrücken suchte, indem man die eigenen Reformforderungen mit der Legitimität eines unvordenklichen Alters versah. Die Verfassungsdebatte der Revolutionszeit wurde vielfach als historische Debatte um Ursprung, Alter und wahres Wesen der landständischen Verfassungen geführt. Die Entwicklung der Geschichtsschreibung über die Landstände seit dem frühen 19. Jahrhundert ist nicht losgelöst von diesen verfassungspolitischen Umständen ihrer Entstehungszeit zu begreifen. Die Rekonstruktion dieser Zusammenhänge ist daher unter anderem als Beitrag zur Selbstreflexion der historiographischen Begrifflichkeit zu verstehen.
Anhand der Verwendung des Repräsentationsbegriffs seit dem 17. Jh. läßt sich nachzeichnen, wie das traditionelle herrschaftsständisch-korporative Prinzip politischer Partizipation allmählich ausgehöhlt wurde. Im Gehäuse der hergebrachten Formen machten sich neue Inhalte breit. Die Staatsrechtler meinten mit landständischer Repräsentation bis weit ins 18. Jh. noch vor allem, daß den Ständen die Kompetenz zukomme, ihr korporatives Handeln der Gesamtheit der Untertanen - unabhängig von deren Willen - verbindlich zuzurechnen und sie darauf zu verpflichten. Gegen Ende des 18. Jhs. wurde dieses Verhältnis von Grund und Folge im Vorgang der Repräsentation umgekehrt: Nun meinte man mit landständischer Repräsentation, daß die Stände vom Volk abgeleitete Rechte ausübten und dem Willen des Volkes Ausdruck verliehen oder doch verleihen sollten. Ging es bei dem älteren Repräsentationsbegriff um die korporative Handlungsfähigkeit der Stände selbst, so postulierte der neue die politische Handlungsfähigkeit der nicht-privilegierten Untertanen. Die Tatsache, daß die Landstände dem neuen Anspruch aufgrund ihrer Struktur kaum entsprechen konnten, wurde nun zum Ansatzpunkt der Kritik und führte zu Reformvorschlägen, die die herrschaftlich-korporative Struktur der Landstände mehr oder weniger offen in Frage stellten. Die Französische Revolution löste in verschiedenen Territorien eine Welle neuer Partizipationsforderungen aus. Sie legte zum einen das Legitimationsdefizit der Landstände bloß, machte die traditionellen Landtage aber zum anderen zum Gegenstand aktueller Reformhoffnungen. Am Beispiel der Konflikte in einzelnen Territorien zeigt sich indessen, daß die Landtage im Rahmen der Reichsverfassung aus sich selbst heraus kaum reformfähig waren.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
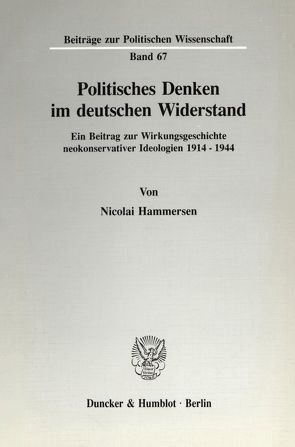
Eine Auseinandersetzung mit den politisch-historischen Wurzeln des deutschen Widerstandes wie auch seine geistesgeschichtliche Einordnung haben bislang noch nicht stattgefunden. Daß die Opposition gegen Hitler der neukonservativen Publizistik der Weimarer Republik nahegestanden und Ideen ihrer Kritiker fortgeführt hat, darauf ist hier und da hingewiesen worden. Die systematische Überprüfung legt eine deutliche Wesensverwandtschaft offen. Worin diese Verwandtschaft im einzelnen besteht, versucht die Untersuchung mit Blick auf den Fundus politischer Ordnungs- und Wertvorstellungen zu zeigen, aus dem die Widerstandskämpfer offensichtlich geschöpft haben. In der Nachfolge der »Ideen von 1914« richtet sich das Augenmerk dabei vor allem auf die Adepten des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. Die Quellen belegen eindrucksvoll die Anknüpfung des politischen Denkens in der nationalkonservativen Opposition an neokonservative Begriffe und Ideologien, in deren Genealogie man viele ihrer Mitglieder verzeichnen kann. Sie haben im großen und ganzen den »geistigkulturellen deutschen Sonderweg« (Nipperdey) nicht überwunden, sondern fortgesetzt.
Mit dem Versuch, den historischen Ort des deutschen Widerstandes in der (geistes-)geschichtlichen Kontinuität konservativen Denkens aufzuzeigen, wird das Verständnis seiner politischen Vorstellungswelt erst möglich und einer adäquaten Beurteilung unter Berücksichtigung der Zeitverhaftung politischen Denkens der Weg geebnet. Das Bedürfnis nach »kritischen Gutachten zur Geschichte« wird dabei nicht befriedigt. Es geht nicht darum, dem Widerstand Fortschrittlichkeit oder eine reaktionäre Einstehung bescheinigen zu wollen, sondern darum, der historischen Wirklichkeit gerecht zu werden, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dies wird durch ein teilnehmendes Interesse gewährleistet, das sich dem Versuch versagt, mit dem erhobenen Zeigefinger des Nachgeborenen darüber zu rechten, welches die guten und welches die bösen, die richtigen und die falschen politischen Ideen sind. Der rückschauende Betrachter nimmt weder den Blickwinkel demokratischer Nachkriegswirklichkeit ein, noch setzt er die gegenwärtige politische Kultur anderen Zeiten und Menschen zum Maß. Er möchte vielmehr zeigen, wie es eigentlich gewesen, und nicht, was sich eigentlich hätte ereignen sollen.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
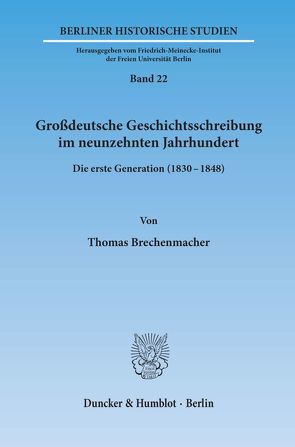
Großdeutsche Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert: damit sind die vielfältig ausgeprägten Ansätze vor allem konservativer, dem Katholizismus nahestehender Historiker bezeichnet, der dominanten borussianischen Geschichtsdeutung entgegenzutreten. Wollte diese die Notwendigkeit eines kleindeutschen Nationalstaates unter preußischer Führung aus dem Verlauf der deutschen Geschichte ableiten, erscheint als Hauptcharakteristikum der großdeutschen Alternative das Bestreben, eine staatliche Neuordnung nicht unter Verzicht auf einen Teil Deutschlands zuzugeben, der dessen Geschicke über viele Jahrhunderte hinweg so maßgeblich bestimmte. Aber nicht nur der Hinweis auf die Rolle Österreichs steht im Zentrum der großdeutschen Geschichtsbilder, sondern der Versuch einer angemesseneren Würdigung der gesamten Reichsgeschichte mit ihren gewachsenen Ordnungen und Traditionen, von den Ottonen bis zum Ende von 1806.
Die Geschichte der großdeutschen Historiographie im 19. Jahrhundert beabsichtigt, eine Erinnerungslücke innerhalb der Geschichte des Faches zu schließen. Sie legt dar, warum diese Historiographie für ihre Zeit bedeutend war, worin ihre Leistungen, worin ihre Irrtümer lagen, sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Kenntnis und Erkenntnis deutscher Geschichte als auch hinsichtlich der Ausbildung der wissenschaftlichen Disziplin "Geschichte". Die vorliegende Arbeit entwickelt hierfür zunächst ein weites Konzept, das nicht nur die Jahre der tagespolitischen Aktualität des Großdeutsch-Kleindeutsch-Gegensatzes zwischen 1848/49 und 1866/71 umgreift, sondern über drei Historikergenerationen hinweg die Zeit der eigentlichen Entstehung großdeutscher Geschichtsschreibung seit etwa 1830 ebenso mit einbezieht wie deren Weiter- und Umbildung in den Jahren nach der Reichsgründung, bis ins 20. Jahrhundert hinein (Einleitung). Der anschließend ausgeführte, in sich geschlossene erste Teil dieses Konzepts behandelt dann anhand der Werke sowie anhand von Korrespondenzen und unveröffentlichtem Nachlaßmaterial die Grundlegungen und Anfänge großdeutscher Historiographie zwischen 1830 und 1848 am Beispiel fünf ausgewählter Historiker der "ersten Generation": Johann Friedrich Böhmer, Friedrich Emanuel Hurter, August Friedrich Gfrörer, Ignaz Döllinger und Constantin Höfler.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
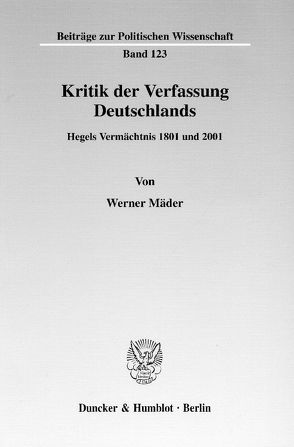
Integration und Desintegration sind ein zentrales Thema der Geisteswissenschaften. Auf makropolitischer Ebene gilt das besondere Interesse dem Entstehen und Vergehen von Staaten, entscheiden sich doch hiermit existenzielle Fragen des Seins einer politischen Gemeinschaft. Auf mikropolitischer Ebene geht es um die Frage, inwieweit dem Bürger "aufgegeben" ist, sich in Gesellschaft und Staat zu integrieren. Supranationalisierung und Globalisierung lassen die Kraft des Nationalstaates schwinden. Dem Übergang der Moderne in die Postmoderne entspricht der Übergang von der Welt der Staaten mit ihren durch Grenzen abgeschlossenen Territorien zur Welt der Kontinente, Gemeinschaften und Netzwerke. Doch gibt es viele Stimmen, die meinen, der Staat sei auf absehbare Zeit nicht wegzudenken und als politische Gemeinschaft zu schützen.
Werner Mäder ist anderer Auffassung: "Deutschland ist kein Staat mehr ..." lautet sein Befund. Der Autor zieht Parallelen zu Hegels Schrift "Kritik der Verfassung Deutschlands" aus dem Jahre 1801 und seinen Kriterien des Staates. Nach Mäder ist das Grundgesetz nur noch eine "Gedankenverfassung", seine fundamentalen Voraussetzungen Staat, Souveränität, Nation, Volk und Demokratie substanziell ausgezehrt. Für Europa bedeutet dies, sich mit eigener Identität selbst zu behaupten, um den Souveränitätsverlust seiner Länder auszugleichen und auf eine neue Multipolarität der internationalen Beziehungen hinzuarbeiten.
Aktualisiert: 2023-05-11
> findR *
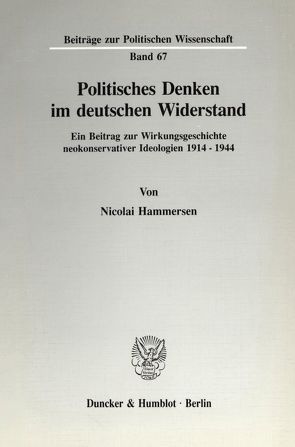
Eine Auseinandersetzung mit den politisch-historischen Wurzeln des deutschen Widerstandes wie auch seine geistesgeschichtliche Einordnung haben bislang noch nicht stattgefunden. Daß die Opposition gegen Hitler der neukonservativen Publizistik der Weimarer Republik nahegestanden und Ideen ihrer Kritiker fortgeführt hat, darauf ist hier und da hingewiesen worden. Die systematische Überprüfung legt eine deutliche Wesensverwandtschaft offen. Worin diese Verwandtschaft im einzelnen besteht, versucht die Untersuchung mit Blick auf den Fundus politischer Ordnungs- und Wertvorstellungen zu zeigen, aus dem die Widerstandskämpfer offensichtlich geschöpft haben. In der Nachfolge der »Ideen von 1914« richtet sich das Augenmerk dabei vor allem auf die Adepten des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. Die Quellen belegen eindrucksvoll die Anknüpfung des politischen Denkens in der nationalkonservativen Opposition an neokonservative Begriffe und Ideologien, in deren Genealogie man viele ihrer Mitglieder verzeichnen kann. Sie haben im großen und ganzen den »geistigkulturellen deutschen Sonderweg« (Nipperdey) nicht überwunden, sondern fortgesetzt.
Mit dem Versuch, den historischen Ort des deutschen Widerstandes in der (geistes-)geschichtlichen Kontinuität konservativen Denkens aufzuzeigen, wird das Verständnis seiner politischen Vorstellungswelt erst möglich und einer adäquaten Beurteilung unter Berücksichtigung der Zeitverhaftung politischen Denkens der Weg geebnet. Das Bedürfnis nach »kritischen Gutachten zur Geschichte« wird dabei nicht befriedigt. Es geht nicht darum, dem Widerstand Fortschrittlichkeit oder eine reaktionäre Einstehung bescheinigen zu wollen, sondern darum, der historischen Wirklichkeit gerecht zu werden, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dies wird durch ein teilnehmendes Interesse gewährleistet, das sich dem Versuch versagt, mit dem erhobenen Zeigefinger des Nachgeborenen darüber zu rechten, welches die guten und welches die bösen, die richtigen und die falschen politischen Ideen sind. Der rückschauende Betrachter nimmt weder den Blickwinkel demokratischer Nachkriegswirklichkeit ein, noch setzt er die gegenwärtige politische Kultur anderen Zeiten und Menschen zum Maß. Er möchte vielmehr zeigen, wie es eigentlich gewesen, und nicht, was sich eigentlich hätte ereignen sollen.
Aktualisiert: 2023-05-11
> findR *
Aktualisiert: 2023-04-15
> findR *
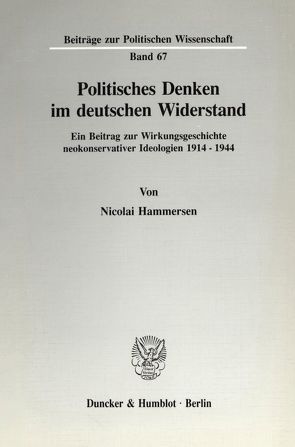
Eine Auseinandersetzung mit den politisch-historischen Wurzeln des deutschen Widerstandes wie auch seine geistesgeschichtliche Einordnung haben bislang noch nicht stattgefunden. Daß die Opposition gegen Hitler der neukonservativen Publizistik der Weimarer Republik nahegestanden und Ideen ihrer Kritiker fortgeführt hat, darauf ist hier und da hingewiesen worden. Die systematische Überprüfung legt eine deutliche Wesensverwandtschaft offen. Worin diese Verwandtschaft im einzelnen besteht, versucht die Untersuchung mit Blick auf den Fundus politischer Ordnungs- und Wertvorstellungen zu zeigen, aus dem die Widerstandskämpfer offensichtlich geschöpft haben. In der Nachfolge der »Ideen von 1914« richtet sich das Augenmerk dabei vor allem auf die Adepten des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. Die Quellen belegen eindrucksvoll die Anknüpfung des politischen Denkens in der nationalkonservativen Opposition an neokonservative Begriffe und Ideologien, in deren Genealogie man viele ihrer Mitglieder verzeichnen kann. Sie haben im großen und ganzen den »geistigkulturellen deutschen Sonderweg« (Nipperdey) nicht überwunden, sondern fortgesetzt.
Mit dem Versuch, den historischen Ort des deutschen Widerstandes in der (geistes-)geschichtlichen Kontinuität konservativen Denkens aufzuzeigen, wird das Verständnis seiner politischen Vorstellungswelt erst möglich und einer adäquaten Beurteilung unter Berücksichtigung der Zeitverhaftung politischen Denkens der Weg geebnet. Das Bedürfnis nach »kritischen Gutachten zur Geschichte« wird dabei nicht befriedigt. Es geht nicht darum, dem Widerstand Fortschrittlichkeit oder eine reaktionäre Einstehung bescheinigen zu wollen, sondern darum, der historischen Wirklichkeit gerecht zu werden, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dies wird durch ein teilnehmendes Interesse gewährleistet, das sich dem Versuch versagt, mit dem erhobenen Zeigefinger des Nachgeborenen darüber zu rechten, welches die guten und welches die bösen, die richtigen und die falschen politischen Ideen sind. Der rückschauende Betrachter nimmt weder den Blickwinkel demokratischer Nachkriegswirklichkeit ein, noch setzt er die gegenwärtige politische Kultur anderen Zeiten und Menschen zum Maß. Er möchte vielmehr zeigen, wie es eigentlich gewesen, und nicht, was sich eigentlich hätte ereignen sollen.
Aktualisiert: 2023-04-15
> findR *
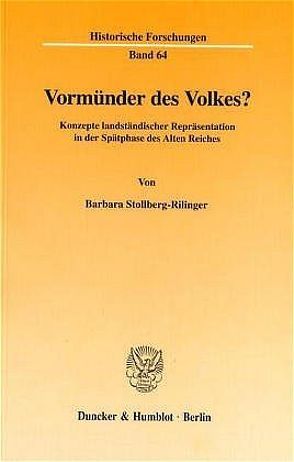
Die landständischen Verfassungen in den Territorien des frühneuzeitlichen Reiches sind von der historischen Forschung gern als Vorläufer des modernen Parlamentarismus aufgefaßt worden. Diese Deutung war von dem Bemühen um demokratisch-rechtsstaatliche Traditionsstiftung geleitet; für sie schien zu sprechen, daß die vormodernen Landstände schon von den Zeitgenossen als »Repräsentanten der Untertanen« bezeichnet worden waren. Im Gegensatz zu dieser älteren Auffassung wird hier die These vertreten, daß ein begrifflicher Bruch das ältere Verständnis ständischer Repräsentation von dem des 19. und 20. Jahrhunderts trennt - ein revolutionärer Bruch, den man allerdings schon im frühen 19. Jh. zu verschleiern oder zu überbrücken suchte, indem man die eigenen Reformforderungen mit der Legitimität eines unvordenklichen Alters versah. Die Verfassungsdebatte der Revolutionszeit wurde vielfach als historische Debatte um Ursprung, Alter und wahres Wesen der landständischen Verfassungen geführt. Die Entwicklung der Geschichtsschreibung über die Landstände seit dem frühen 19. Jahrhundert ist nicht losgelöst von diesen verfassungspolitischen Umständen ihrer Entstehungszeit zu begreifen. Die Rekonstruktion dieser Zusammenhänge ist daher unter anderem als Beitrag zur Selbstreflexion der historiographischen Begrifflichkeit zu verstehen.
Anhand der Verwendung des Repräsentationsbegriffs seit dem 17. Jh. läßt sich nachzeichnen, wie das traditionelle herrschaftsständisch-korporative Prinzip politischer Partizipation allmählich ausgehöhlt wurde. Im Gehäuse der hergebrachten Formen machten sich neue Inhalte breit. Die Staatsrechtler meinten mit landständischer Repräsentation bis weit ins 18. Jh. noch vor allem, daß den Ständen die Kompetenz zukomme, ihr korporatives Handeln der Gesamtheit der Untertanen - unabhängig von deren Willen - verbindlich zuzurechnen und sie darauf zu verpflichten. Gegen Ende des 18. Jhs. wurde dieses Verhältnis von Grund und Folge im Vorgang der Repräsentation umgekehrt: Nun meinte man mit landständischer Repräsentation, daß die Stände vom Volk abgeleitete Rechte ausübten und dem Willen des Volkes Ausdruck verliehen oder doch verleihen sollten. Ging es bei dem älteren Repräsentationsbegriff um die korporative Handlungsfähigkeit der Stände selbst, so postulierte der neue die politische Handlungsfähigkeit der nicht-privilegierten Untertanen. Die Tatsache, daß die Landstände dem neuen Anspruch aufgrund ihrer Struktur kaum entsprechen konnten, wurde nun zum Ansatzpunkt der Kritik und führte zu Reformvorschlägen, die die herrschaftlich-korporative Struktur der Landstände mehr oder weniger offen in Frage stellten. Die Französische Revolution löste in verschiedenen Territorien eine Welle neuer Partizipationsforderungen aus. Sie legte zum einen das Legitimationsdefizit der Landstände bloß, machte die traditionellen Landtage aber zum anderen zum Gegenstand aktueller Reformhoffnungen. Am Beispiel der Konflikte in einzelnen Territorien zeigt sich indessen, daß die Landtage im Rahmen der Reichsverfassung aus sich selbst heraus kaum reformfähig waren.
Aktualisiert: 2023-04-15
> findR *
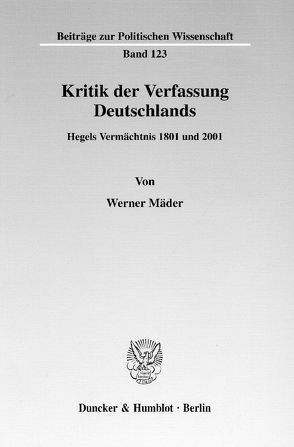
Integration und Desintegration sind ein zentrales Thema der Geisteswissenschaften. Auf makropolitischer Ebene gilt das besondere Interesse dem Entstehen und Vergehen von Staaten, entscheiden sich doch hiermit existenzielle Fragen des Seins einer politischen Gemeinschaft. Auf mikropolitischer Ebene geht es um die Frage, inwieweit dem Bürger "aufgegeben" ist, sich in Gesellschaft und Staat zu integrieren. Supranationalisierung und Globalisierung lassen die Kraft des Nationalstaates schwinden. Dem Übergang der Moderne in die Postmoderne entspricht der Übergang von der Welt der Staaten mit ihren durch Grenzen abgeschlossenen Territorien zur Welt der Kontinente, Gemeinschaften und Netzwerke. Doch gibt es viele Stimmen, die meinen, der Staat sei auf absehbare Zeit nicht wegzudenken und als politische Gemeinschaft zu schützen.
Werner Mäder ist anderer Auffassung: "Deutschland ist kein Staat mehr ..." lautet sein Befund. Der Autor zieht Parallelen zu Hegels Schrift "Kritik der Verfassung Deutschlands" aus dem Jahre 1801 und seinen Kriterien des Staates. Nach Mäder ist das Grundgesetz nur noch eine "Gedankenverfassung", seine fundamentalen Voraussetzungen Staat, Souveränität, Nation, Volk und Demokratie substanziell ausgezehrt. Für Europa bedeutet dies, sich mit eigener Identität selbst zu behaupten, um den Souveränitätsverlust seiner Länder auszugleichen und auf eine neue Multipolarität der internationalen Beziehungen hinzuarbeiten.
Aktualisiert: 2023-04-15
> findR *
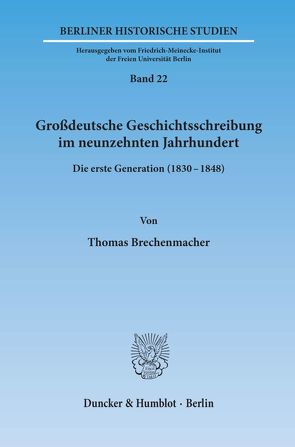
Großdeutsche Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert: damit sind die vielfältig ausgeprägten Ansätze vor allem konservativer, dem Katholizismus nahestehender Historiker bezeichnet, der dominanten borussianischen Geschichtsdeutung entgegenzutreten. Wollte diese die Notwendigkeit eines kleindeutschen Nationalstaates unter preußischer Führung aus dem Verlauf der deutschen Geschichte ableiten, erscheint als Hauptcharakteristikum der großdeutschen Alternative das Bestreben, eine staatliche Neuordnung nicht unter Verzicht auf einen Teil Deutschlands zuzugeben, der dessen Geschicke über viele Jahrhunderte hinweg so maßgeblich bestimmte. Aber nicht nur der Hinweis auf die Rolle Österreichs steht im Zentrum der großdeutschen Geschichtsbilder, sondern der Versuch einer angemesseneren Würdigung der gesamten Reichsgeschichte mit ihren gewachsenen Ordnungen und Traditionen, von den Ottonen bis zum Ende von 1806.
Die Geschichte der großdeutschen Historiographie im 19. Jahrhundert beabsichtigt, eine Erinnerungslücke innerhalb der Geschichte des Faches zu schließen. Sie legt dar, warum diese Historiographie für ihre Zeit bedeutend war, worin ihre Leistungen, worin ihre Irrtümer lagen, sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Kenntnis und Erkenntnis deutscher Geschichte als auch hinsichtlich der Ausbildung der wissenschaftlichen Disziplin "Geschichte". Die vorliegende Arbeit entwickelt hierfür zunächst ein weites Konzept, das nicht nur die Jahre der tagespolitischen Aktualität des Großdeutsch-Kleindeutsch-Gegensatzes zwischen 1848/49 und 1866/71 umgreift, sondern über drei Historikergenerationen hinweg die Zeit der eigentlichen Entstehung großdeutscher Geschichtsschreibung seit etwa 1830 ebenso mit einbezieht wie deren Weiter- und Umbildung in den Jahren nach der Reichsgründung, bis ins 20. Jahrhundert hinein (Einleitung). Der anschließend ausgeführte, in sich geschlossene erste Teil dieses Konzepts behandelt dann anhand der Werke sowie anhand von Korrespondenzen und unveröffentlichtem Nachlaßmaterial die Grundlegungen und Anfänge großdeutscher Historiographie zwischen 1830 und 1848 am Beispiel fünf ausgewählter Historiker der "ersten Generation": Johann Friedrich Böhmer, Friedrich Emanuel Hurter, August Friedrich Gfrörer, Ignaz Döllinger und Constantin Höfler.
Aktualisiert: 2023-04-15
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung
Sie suchen ein Buch über Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Deutschland /Politische Theorie, Geschichtsschreibung und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.