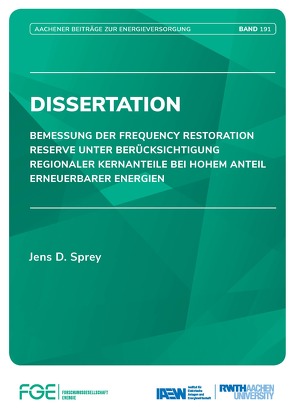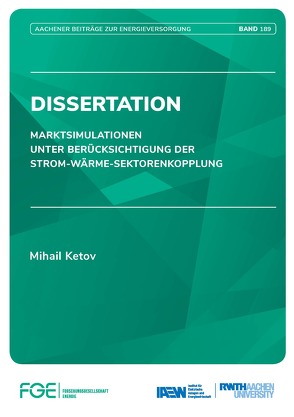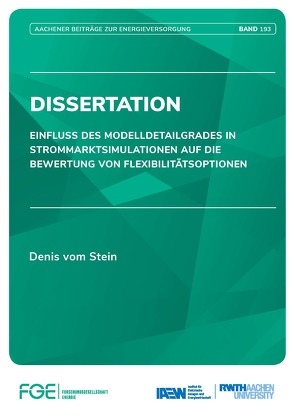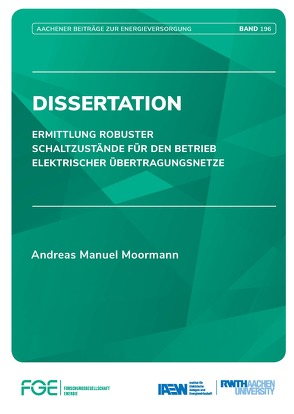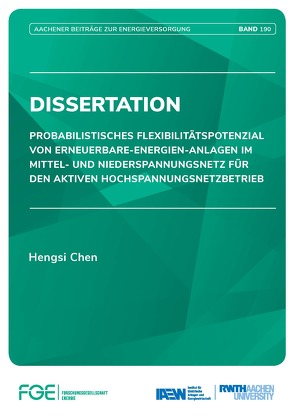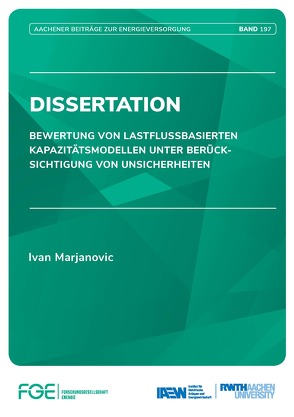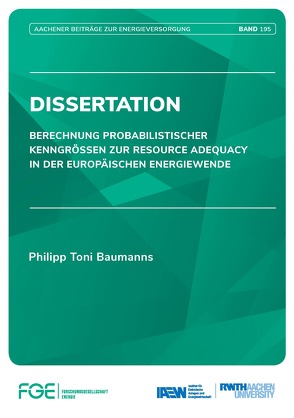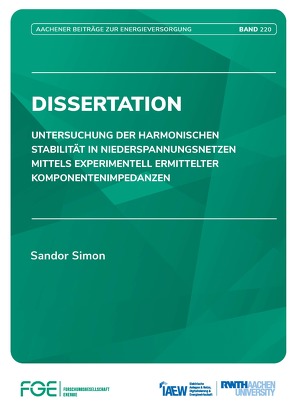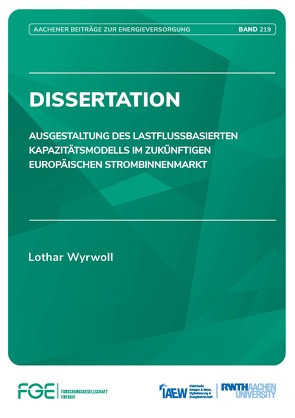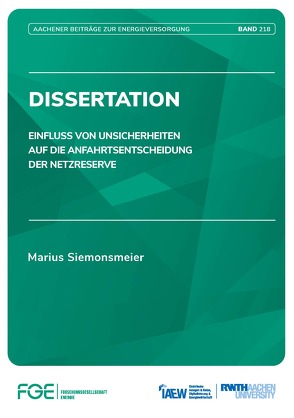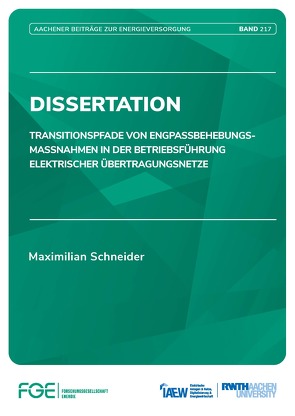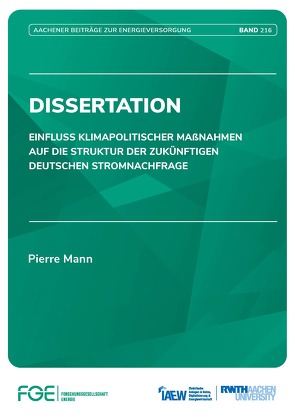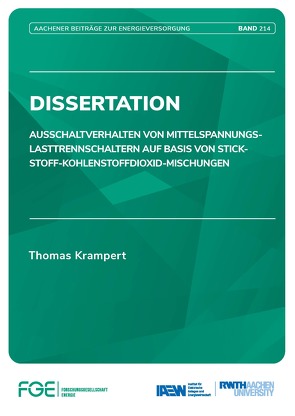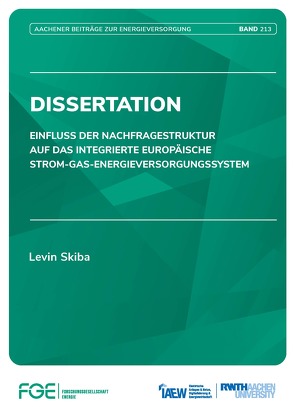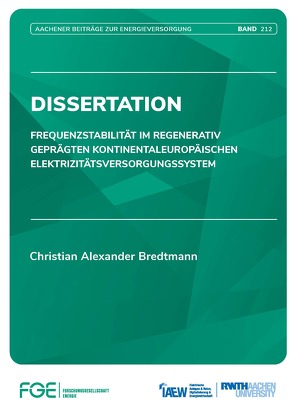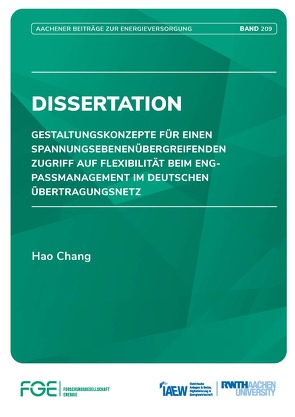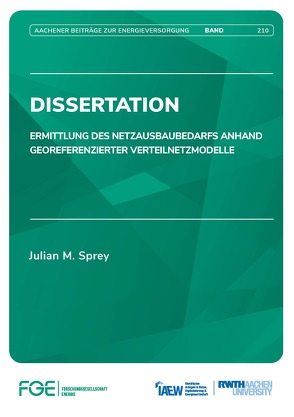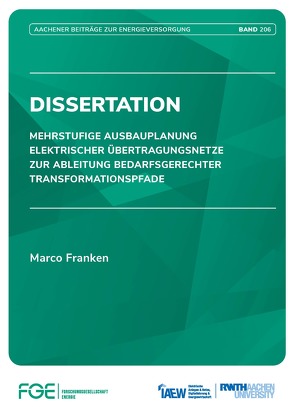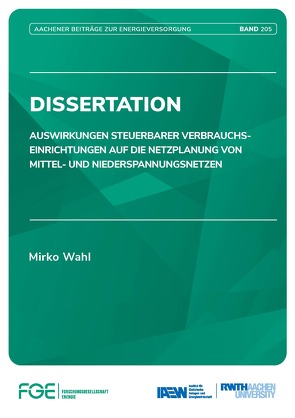Das Ziel dieser Arbeit ist es, die FRR-Bemessung im Hinblick auf diese sich abzeichnenden Entwicklungen effizient auszugestalten.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
Marksimulationen unter Berücksichtigung der Strom-Wärme-Sektorenkopplung
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
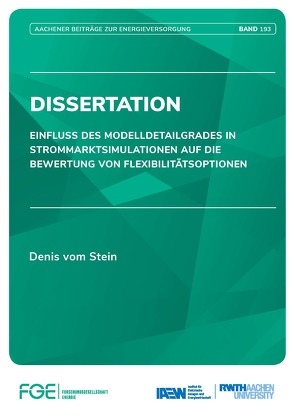
Aufgrund politischer Klimaschutzziele ist ein weiterer Zubau von Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien zu erwarten. Die Dargebotsabhängigkeit und bedingte Prognostizierbarkeit der Einspeisung führen zu steigenden Unsicherheiten und erhöhtem Flexibilitätsbedarf im Elektrizitätsversorgungssystem. Dabei ermöglichen bereits heute bspw. Intraday-Handelsprodukte mit viertelstündlicher Granularität einen standardisierten Handel zur Deckung dieses Flexibilitätsbedarfs. Die Einführung flussbasierter Kapazitätsallokation, politisch angestrebte Mindestübertragungskapazitäten sowie ein gebotszonenübergreifender Intraday-Handel verstärken zudem den internationalen Wettbewerb von Flexibilitätsoptionen. Für die gesamtwirtschaftliche Bewertung von Flexibilitätsoptionen sind Strommarktsimulationen ein elementares Werkzeug. Bestehende Verfahren unterscheiden sich im Modelldetailgrad jedoch erheblich. Die wesentlichen Modellierungsdimensionen sind die Abbildung von Unsicherheiten, der verschiedenen Technologien mit ihren technischen und betrieblichen Restriktionen, die zeitliche Granularität sowie der geographische Betrachtungsraum in Verbindung mit dem Market Coupling. Aufgrund beschränkter Ressourcen, hinsichtlich Rechenleistung und -zeit bedarf es eines Trade-offs im Detailgrad innerhalb und zwischen den Modellierungsdimensionen. Daher ist das Ziel dieser Arbeit, ein Vorgehen für die Unterstützung von Modellierungsentscheidungen zu erarbeiten. Dafür wird der Einfluss des Modelldetailgrades in Strommarktsimulationen auf die Bewertung von Flexibilitätsoptionen quantifiziert und notwendige Detailgrade identifiziert.
Im Rahmen der Analyse erfolgt eine Bestandsaufnahme der in Realität auftretenden Unsicherheiten, Marktabläufe, Flexibilitätsbedarfe und -angebote, welche in Kontext zu den vier skizzierten Modellierungsdimensionen gesetzt werden. Darauf aufbauend wird eine Auswahl an Modellen mit unterschiedlichem Detailgrad für die jeweiligen Dimensionen mathematisch formuliert. Das entwickelte modulare mehrstufige Simulationsverfahren, welches sich an den derzeitigen Planungsstufen von Marktakteuren orientiert, erlaubt eine flexible Modellkombination. Für verschiedene Kombinationen kann damit über Simulationen der fundamentale potentielle Mehrwert einer Flexibilitätsoption an den Strommärkten aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive ermittelt und somit der Einfluss des Modelldetailgrades bestimmt werden.
Die exemplarischen Untersuchungen zeigen, dass die Modellierungsentscheidung in allen vier Dimensionen einen signifikanten Einfluss auf den ermittelten Mehrwert einer Flexibilitätsoption hat. Der durch die systemisch eingesparten Stromerzeugungskosten quantifizierte Mehrwert einer zusätzlichen Flexibilitätsoption liegt in Abhängigkeit der Modellauswahl im Vergleich zu einer definierten Referenzrechnung zwischen etwa 35 und 130 Prozent. Eine besondere Bedeutung erhalten dabei die Dimensionen der kurzfristigen Unsicherheiten der Residuallast und des Market Couplings. Die stochastische Berücksichtigung von Unsicherheiten führt zu einem deutlichen Mehrwert der Flexibilitätsoption im Vergleich zu einer Simulation unter perfekter Voraussicht oder unter deterministischen Prognoseupdates. Dabei stellt die ermittelte Modellauswahl keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, jedoch kann das Vorgehen für die Unterstützung von Modellierungsentscheidungen auf weitere Fragestellungen übertragen werden.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
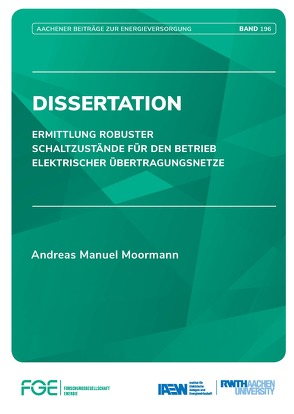
Anhaltende Entwicklungen in der Elektrizitätsversorgung, unter anderem der signifikante Zubau von dargebotsabhängigen Erzeugungsanlagen, führen zu einem erhöhten Bedarf von Anpas-sungsmaßnahmen, um Engpässe im Übertragungsnetz zu vermeiden. Damit Maßnahmen mit hoher Vorlaufzeit rechtzeitig aktiviert werden können, kommt der Betriebsplanung bei der Eng-passbehebung eine zunehmende Bedeutung zu.
Schaltmaßnahmen zur Veränderung des Schaltzustands des Übertragungsnetzes stellen ein na-hezu kostenfreies Mittel des Netzbetriebs dar, deren Verwendung zudem den Anpassungen der Transportaufgabe gesetzlich vorzuziehen ist. Bei der Berücksichtigung von Schaltmaßnahmen in der Betriebsplanung sind jedoch umfangreiche Randbedingungen zu beachten:
• Das Auftreten komplexer Schaltsequenzen und die begrenzte Zuverlässigkeit von Schaltge-räten erfordert die explizite Prüfung der Schaltmaßnahmen. Die bloße Betrachtung des resul-tierenden Schaltzustands ist nicht ausreichend.
• Um einen gleichmäßigen Schaltbetrieb gewährleisten zu können, ist die vorausschauende Auswahl von Schaltzuständen erforderlich, die möglichst längerfristig zulässig sind.
• Die Koordination von Schaltmaßnahmen erfordert die Ermittlung einer begrenzten Menge von Schaltzuständen, die für einen längeren Zeitraum effektiv eingesetzt werden kann.
Im heutigen Netzbetrieb werden die umfangreichen Randbedingungen vereinfacht berücksichtigt, indem das Übertragungsnetz üblicherweise im sogenannten Normalschaltzustand betrieben wird. Hiervon wird nur in geringem Umfang abgewichen. Um jedoch das Potential des Schaltzustands unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen möglichst effizient auszunutzen, wird in dieser Arbeit das Konzept der robusten Schaltzustände (rSZ) entwickelt.
Zur Ermittlung von rSZ wird ein Verfahren mit verschiedenen Bausteinen vorgeschlagen. Zu-nächst wird eine als stochastischer Prozess modellierte repräsentative Netznutzung auf Basis historischer Netznutzungsfälle hergeleitet. Dabei werden repräsentative Netznutzungsfälle mit Hilfe eines Clustering-Verfahrens ermittelt. Auf dieser Basis können im nächsten Schritt rSZ unter gleichzeitiger Berücksichtigung der erforderlichen Schaltmaßnahmen mit Hilfe eines geeigneten Optimierungsverfahrens ermittelt werden. Im entwickelten Verfahren werden Strom-, Spannungs- und Kurzschlussstromgrenzwerte und weitere Nebenbedingungen für Schaltmaßnahmen berück-sichtigt. Die Bestimmung von kurativen Schaltmaßnahmen zur Engpassbehebung nach Betriebs-mittelausfall ist ebenfalls möglich. Zur Herabsetzung der Problemdimension teilt sich das Verfah-ren in ein Sub- und Masterproblem auf. Das Subproblem ermittelt eine Vorschlagsliste von opti-mierten Schaltzuständen pro repräsentativem Netznutzungsfall. Im Masterproblem werden die insgesamt optimalen – und damit robusten – Schaltzustände bestimmt. Dabei werden insbeson-dere die sich einstellenden Schaltmaßnahmen mit Hilfe einer Modellierung des Risikos und der Zuverlässigkeit bewertet. Die auf diese Weise ermittelten rSZ können anschließend in Prozessen der Betriebsplanung zur Beseitigung von Engpässen eingesetzt werden. Dazu wird ein Verfah-rensbaustein entwickelt, der auf Basis der prognostizierten Netznutzung eine Auswahl der zur Verfügung stehenden rSZ mit nur geringem Bedarf an Rechenzeit vornimmt.
Exemplarische Untersuchung zeigen anhand der Simulation eines Betriebsplanungsprozesses, dass erfolgreich Schaltmaßnahmen auf Basis der rSZ zur Beseitigung von Engpässen herange-zogen werden können. Auf diese Weise kann der Umfang sonstiger erforderlicher Maßnahmen zur Engpassbehebung, insbesondere Eingriffe in die Transportaufgabe, reduziert werden
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
Im Rahmen dieser Arbeit wird das technische Flexibilitätspotenzial als technisch mögliche maximale Auslenkung des P-/Q-Austauschs am HS/MS-Umspannwerk definiert.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
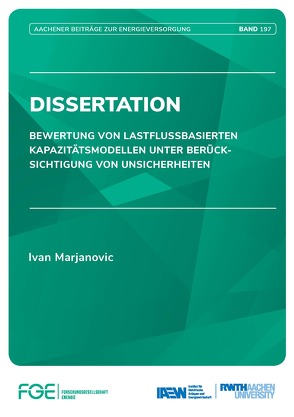
Durch den steigenden Anteil der Stromerzeugung auf Basis lastferner und dargebotsabhängiger erneuerbarer Energien sind die Leistungsflüsse im europäischen Übertragungsnetz zunehmend weiträumig und schwierig zu prognostizieren. Dies bewirkt eine Verringerung der Übertragungs¬kapazitäten, die für den Handel zwischen Gebotszonen im europäischen Strommarkt verfügbar sind. Eine effiziente Allokation von Übertragungskapazitäten, die zur Maximierung der ökono¬mischen Wohlfahrt unter Gewährleistung der Netzsicherheit führt, soll künftig mithilfe eines last-flussbasierten Kapazitätsmodells in weiten Teilen Europas erfolgen. Dabei spielt die Ausgestal¬tung der Kapazitätsberechnung (Kapazitätsmodell) eine wesentliche Rolle. Aktuelle Diskussionen zur neuen Strombinnenmarkt-Verordnung zeigen die ökonomische und technische Relevanz für eine Vielzahl an Akteure auf.
Zur Beurteilung der zukünftigen Auswirkungen eines Kapazitätsmodells ist eine techno-ökono-mische Bewertung durchzuführen. Diese erfordert eine realitätsnahe Abbildung des Strommark¬tes und des Netzbetriebs, wobei zu berücksichtigen ist, dass zum Zeitpunkt der Kapazitätsbe¬rechnung noch signifikante Unsicherheiten in den Eingangsdaten bestehen.
In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur probabilistischen Bewertung von lastflussbasierten Kapazitätsmodellen entwickelt, das die Quantifizierung möglicher Auswir¬kungen auf den Strommarkt und den Netzbetrieb unter Berücksichtigung von Unsicherheiten er¬möglicht. Das entwickelte Verfahren bildet drei Prozesse über zwei Zeitbereiche ab. Die Kapa¬zitätsberechnung, der Strommarkt sowie die Netzbetriebsplanung werden zunächst im vortäg¬lichen Zeitbereich simuliert. Die Entscheidungsfindung wird dabei über eine gemischt-ganz¬zahlige Optimierung modelliert, als Grundlage dienen die vortäglichen Prognosen der relevanten Eingangsgrößen. Anschließend werden im Rahmen einer Monte-Carlo Simulation die möglichen Prognoseabweichungen gezogen und deren Auswirkungen auf den lntraday-Markt und den Netz¬betrieb im Kurzfristbereich (wenige Stunden vor Erfüllung) mit Hilfe einer linearen Optimierung quantifiziert.
Mithilfe des entwickelten Verfahrens werden exemplarische Bewertungen von Kapazitätsmo-dellen durchgeführt. Im Fokus der Untersuchungen stehen die heute diskutierten Ausgestaltungs¬aspekte hinsichtlich der Wahl der zu betrachtenden Netzelemente und des Mindestwerts der Übertragungskapazitäten. Dabei führen weniger restriktive Kapazitätsmodelle tendenziell zur Er¬höhung der ökonomischen Wohlfahrt, da das Engpassmanagement gezielter und volkswirtschaft¬lich effizienter mithilfe von Redispatch als durch Einschränkung des gebotszonenübergreifenden Handels erfolgen kann. Eine Überdimensionierung ist allerdings aufgrund des erhöhten Aufwands für Redispatch, fehlender Preissignale und verzerrter Wohlfahrtsverteilung nicht wünschenswert. Zudem führen bei weniger restriktiven Kapazitätsmodellen mögliche Prognoseabweichungen zur stärkeren Reduktion der erwarteten Gesamtwohlfahrt und zur potentiellen Gefährdung der Netz¬sicherheit. So wird u.a. gezeigt, dass der regulatorisch geforderte Mindestwert von 70% zu keiner höheren Wohlfahrt als ein Mindestwert von 45% führt.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
In dieser Arbeit werden die für die Berechnung der Kenngrößen relevanten Eigenschaften der Ressourcen untersucht und anschließend in entsprechende Modelle überführt.
Aktualisiert: 2023-05-15
> findR *
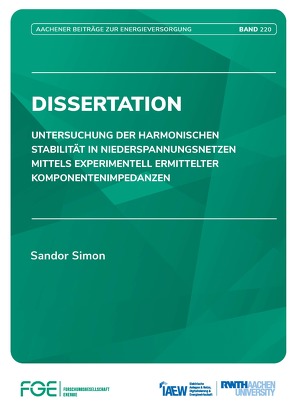
In Niederspannungsnetzen wird ein neuartiges Stabilitätsphänomen beobachtet, das auf den zunehmenden Anteil von geregelten Komponenten mit leistungselektronischen Bauelementen zurückzuführen ist. Bereits aufgetretene Anlagen-ausfälle und eine sich daraus ableitende Gefahr für den stabilen Netzbetrieb verdeutlichen die Notwendigkeit geeigneter Untersuchungen und Gegenmaßnahmen. Ein potentielles Kriterium zur Untersuchung dieser sogenannten harmonischen Stabilität ist das impedanzbasierte Stabilitätskriterium (IBSK), für dessen Anwendung frequenzabhängige Impedanzen
benötigt werden. Dafür sind im Kontext von Niederspannungsnetzen die experimentelle Vermessung von Komponenten im Labor und die Überführung von Messdaten in Ersatzmodelle vorteilhaft, jedoch sind sowohl Kenntnisse über Anforde-rungen und Rahmenbedingungen als auch geeignete Verfahren notwendig.
Daher werden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Teilverfahren einer, auf experimentellen Vermessungen basierenden, Verfahrenskette auf die Anwendbarkeit in Niederspannungsnetzen untersucht, weiterentwickelt und erprobt. Dies sind die
experimentelle Ermittlung von frequenzabhängigen Impedanzen heterogener Niederspannungskomponenten, die Überf-ührung der resultierenden Impedanzen in datengetriebene, parametrische Ersatzmodelle als auch die systemische Unter-suchung der harmonischen Stabilität von unterschiedlichen Niederspannungsnetzen und unter Variation vonNetzeigen-schaften und Durchdringungsgraden.
Die mittels der implementierten und validierten Prüfkreise ermittelten Impedanzen von 24 handelsüblichen Komponenten zeigen eine signifikante Heterogenität und zu berücksichtigende Einflussfaktoren in Niederspannungsnetzen auf. Ver-schiedene Weiterentwicklungen reduzieren durch Nichtlinearitäten hervorgerufene Störeinflüsse und ermöglichen die Vermessung unter den identifizierten Rahmenbedingungen.
Anschließend werden ein Modellierungsansatz und Parametrierungsverfahren vorgestellt sowie Messergebnisse in Er-satzmodelle überführt. Die Ergebnisse der systemischen Untersuchungen zeigen, dass mit einer als passiv angenommenen Netzanbindung die harmonische Stabilität gewährleistet ist. In einer Untersuchung eines Netzes mit leistungselektronischer Netzbildung wird jedoch eine Instabilität prognostiziert. Die
Validierung im Labor bestätigt die Prognose und verdeutlicht die Anwendbarkeit des IBSK unter Verwendung von expe-rimentell parametrierten Ersatzmodellen.
Aktualisiert: 2023-03-23
> findR *
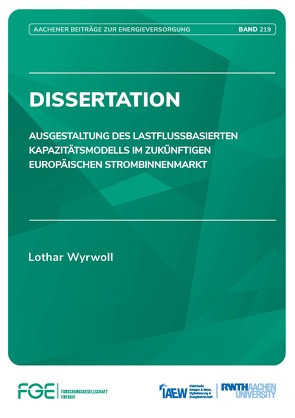
Dem internationalen Stromhandel kommt bei der Dekarbonisierung des europäischen Energieversorgungsystems eine wichtige Bedeutung zu, da er eine europaweit effiziente Verteilung volatiler Einspeisungen aus Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien (EE) ermöglicht. Daher strebt die EU eine immer stärkere Integrationder nationalen Strommärkte unter Berücksichtigung der begrenzten Übertragungskapazitäten an. Zur Kopplung einzelner europäischer Marktgebiete wird neben dem bisher praktizierten Kapazitätsmodell Net-Transfer-Capacities (NTC) seit 2015 sukzessive das Flow-Based Market Coupling (FBMC) eingeführt. Dieses ermöglicht eine effizientere Ausnutzung der physikalischen Übertragungs-kapazitäten, da es die Lastflussverhältnisse im europäischen Übertragungsnetz besser abbildet. Beim FBMC sind eine Reihe von Fragen zur Ausgestaltung ungeklärt. Hierzu zählen u.a., ob eine Erweiterung auf weitere Marktgebiete sinnvoll ist, wie Nicht-FBMCGebotszonen in das FBMC-Kapazitätsmodell zu integrieren sind (sogenanntes Hybrid Market Coupling), wie die Flexibilität leistungsfl usssteuernder Betriebsmittel wie Phasenschiebertransformatoren innerhalb des FBMC-Kapazitätsmodells zu berücksichtigen ist und welche Mindestkapazitäten für Importe und Exporte vorgehalten werden sollen. Die langfristige Ausgestaltung der Marktkopplung im europäischen Strombinnenmarkt stellt das Forschungs-vorhaben der Arbeit dar.
In dieser Forschungsarbeit wird ein Modell zur Systemanalyse entwickelt, um die Berechnung und Nutzung der Übertra-gungskapazitäten abzubilden. Dieses besteht aus den Modulen Kapazitätsberechnung, Gebotserstellung der Handelsteilnehmer, Bestimmung der Preise, Importe und Exporte sowie Nutzung der verfügbaren Übertragungskapazitäten, sowie schließlich dem Management der verbliebenen Engpässe. Das Modell zur Systemanalyse weist als Besonderheiten auf, dass die Marktkopplung nicht innerhalb eines Fundamentalmodells, welches Gebotserstellung und Preisermittlung integriert betrachtet, sondern in Anlehnung an die realen Prozesse in der Preisbestimmung modelliert ist und dass es die Flexibilität lastflusssteuernder Betriebsmittel in der Kapazitätsermittlung abzubilden vermag.
Im Rahmen einer Parameterstudie wird die zukünftige Ausgestaltung des FBMCModells in einem Szenario für das Jahr 2035 anhand der Kriterien Erzeugungskosten, CO2-Emissionen und Abregelung von EE-Anlagen in Folge von Strom-handel und Engpassmanagement bewertet. Insbesondere die Wahl der Mindestkapazitäten stellt sich dabei als sehr sensitiv auf die Bewertungskriterien heraus. Ein neuartiges Konzept des Hybrid Market Couplings, bekannt unter dem Namen Advanced Hybrid Market Coupling, erweist sich hinsichtlich der gewählten Bewertungskriterien, insbesondere bei geringen Mindestkapazitäten, als vorteilhaft. Eine Erweiterung des FBMC-Kapazitätsmodells auf weitere Mitgliedsstaaten am Rande des europäischen Kontinents sowie die Berücksichtigung von Phasenschiebetransformatoren im FBMC-Kapazitätsmodell erscheint dagegen nicht sinnvoll.
Aktualisiert: 2023-02-09
> findR *
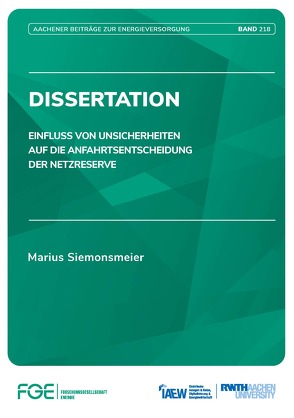
Infolge vielfältiger Veränderungen im Elektrizitätsversorgungssystem steigt das Transporterfordernis im deutschen Über-tragungsnetz. Da die notwendigen Netzausbauvorhabenverzögert sind, nimmt der Bedarf an operativer Netzengpass-behebung zu. Dazu zählen markt- und netzbezogene Maßnahmen sowie zusätzliche Reserven, deren Einsätze im Rahmen der Kurzfristbetriebsplanung bestimmt werden. Dabei stellt die Anfahrtsentscheidung der Netzreserve eine besondere Herausforderung dar, weil diese lange Vorlaufzeiten aufweist und in der gesetzlichen Einsatzreihenfolge erst nachrangig
eingesetzt werden darf. In der Betriebspraxis werden die Anfahrten der Netzreserve mittels prognosebasierter Netz-betriebssimulationen abgeleitet. Zur Beherrschung der hohen Unsicherheiten werden Sicherheitsaufschläge ausgehend von Erfahrungswerten verwendet. Diese Form die Unsicherheiten zu berücksichtigen kann einerseits zu Anfahrten führen, die ex post nicht nötig gewesen wären und damit nicht der gesetzlichen Einsatzreihenfolge entsprechen. Anderseits können zu niedrige Sicherheitsaufschläge die Unsicherheiten unterschätzen und die Netzsicherheit gefährden.
Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Dissertation der Einfluss von Unsicherheiten auf die Anfahrtsentscheidung der Netzreserve untersucht und unterschiedliche Ansätze zur differenzierten Abbildung der Unsicherheiten in Netzbetriebs-simulationen verglichen. Dazu wird ein zweistufiges methodisches Vorgehen entwickelt. Die erste Stufe dient der Abbildung der Unsicherheiten mithilfe von Szenarien. Dabei wird eine Monte-Carlo-Simulation unter Verwendung von Copulas ein-gesetzt, um auf Basis historischer Wetter- und Lastprognosefehler konsistente Szenarien der Einspeisung von Wind-energie- und Photovoltaikanlagen, der Verbraucherlast und der witterungsabhängigen Stromgrenzen der Freileitungen zu generieren. Auf dieser Basis ergänzt eine Kraftwerkseinsatzsimulation die jeweiligen Kraftwerkseinsätze und Handels-austausche. Diese Szenarien gehen in die zweite Verfahrensstufe ein, die als probabilistische oder stochastische Netz-betriebssimulation ausgeführt werden kann. Im Kern basieren beide Simulationen auf einem zweistufigen Optimierungs-problem, das die Anfahrten der Netzreserve und den Einsatz der Maßnahmen zur Behebung aller Engpässe mengen- und kostenmäßig minimiert. Dabei erfolgt die Optimierung in der probabilistischen Simulation für jedes Szenario unabhängig, wohingegen in der stochastischen Simulation die Anfahrten im Erwartungswert über alle Szenarien optimiert werden.
Die exemplarischen Untersuchungen anhand eines Zukunftsszenarios im Jahr 2025 zeigen, dass die Bandbreite der Un-sicherheiten bei der Anfahrtsentscheidung der Netzreserve erheblich ist und insbesondere Extremszenarien hohe Abwei-chungen aufweisen. So führen die vielfältigen Unsicherheiten zu Netzengpässen in anderer Höhe, zu anderen Zeitpunkten oder in anderer geografischer Lage. In der Folge ergeben sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen den Anfahrts-entscheidungen der Netzreservekraftwerke in der Anzahl und Auswahl der Anlagen. Insgesamt wird deutlich, dass die Ableitung der Anfahrtsentscheidung auf Basis der probabilistischen Simulation der Abwägung von Einsatzreihenfolge und Netzsicherheit nicht gerecht wird. Dahingegenist die stochastische Simulation mit gemeinsamer Berücksichtigung der Unsicherheiten im Optimierungsproblem überlegen, weil die Anfahrten einerseits häufi ger in Einklang mit der gesetzlichen Reihenfolge stehen und andererseits mögliche Kombinationen erforderlicher Netzreservekraftwerke erkannt werden und damit ein Beitrag zur Netzsicherheit geleistet wird.
Aktualisiert: 2023-02-09
> findR *
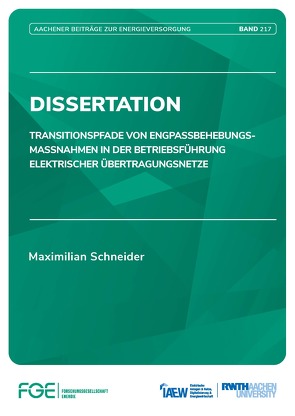
Der Ausbau regenerativer Stromerzeugungsanlagen sowie die Verzögerung notwendiger Netzausbauprojekte führen zunehmend zu Überlastungen im elektrischen Übertragungsnetz. Zur Engpassbehebung stehen Übertragungs-netzbetreibern verschiedene markt- und netzseitige Eingriffsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z.B. die
Modifikation von Kraftwerksfahrplänen durch Redispatch oder das gezielte Anpassen der Netztopologie durch Schaltmaßnahmen. Der erwartete Anstieg an betrieblichen Eingriffen sowie die Höherauslastung des Übertragungsnetzes gehen mitsteigenden Anforderungen an die Koordination und Umsetzung der Maßnahmen einher. Zur Gewährleistung der Durchführbarkeit von Engpassbehebungsmaßnahmen (EBM) ist daher die Bestimmung einer geeigneten zeitlichen Abfolge der Teilmaßnahmen unter Berücksichtigung der betrieblichen Grenzwerte notwendig. Dabei gilt es, die Netzsicherheit in allen Zwischenschritten der Abfolge zu wahren. Der im Rahmen der Arbeit als Untersuchungsgegenstand definierte Transitionspfad beschreibt das Systemverhalten des Übertragungsnetzes unter Berücksichtigung einer veränderlichen Transportaufgabe und eines koordinierten Einsatzes betrieblicher Eingriffe........
Aktualisiert: 2022-11-03
> findR *
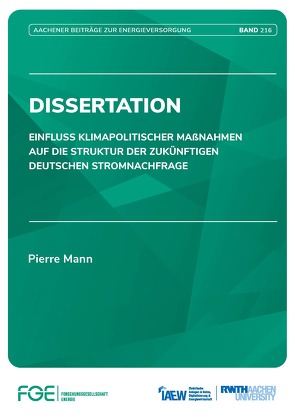
Der Endenergiebedarf nach elektrischer Energie (Stromnachfrage) in Deutschland hat sich in den vergangenen Dekaden kontinuierlich verändert. Diese Veränderung istgeprägt von soziodemographischen und technologischen Entwicklungen sowie derstetigen Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die beobachteten Veränderungen der Strom-nachfrage betreffen deren gesamte Struktur, darunter fallen die energetische Nachfrage, der zeitliche Verlauf und die regi-onale Verortung, sowie mit zunehmender Bedeutung auch die vorhandene Flexibilität.
Auch in Zukunft wird die Entwicklung der Stromnachfragestruktur von der soziodemographischen Entwicklung, den wirt-schaftlichen Rahmenbedingungen und der technologischen Entwicklung beeinflusst. Insbesondere die technologische
Entwicklung wird durch die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung signifikant beeinflusst. Als wesentliche Entwick-lungen sind Effizienzsteigerungen sowie die Elektrifizierung von Wärme- und Mobilitätsanwendungen zu nennen. Die starke
Divergenz von Prognosen zur zukünftigen Stromnachfrage zeigt, dass die Wirkung der klimapolitischen Maßnahmen auf die zukünftige Stromnachfragestruktur von hoher Unsicherheit geprägt ist. Deren Kenntnis ist jedoch essentiell für unterschied-lichste Anwendungen wie beispielsweise Netzplanungsprozesse.
Es stellt sich daher die Frage, wie ein Verfahren zur Simulation der Stromnachfragestruktur unter Berücksichtigung der zu-künftigen Entwicklungen konzipiert sein muss. Ziel dieses Forschungsvorhabens war daher die Entwicklung eines solchen Verfahrens und die anschließende exemplarische Anwendung für zukünftige Szenarien um die Auswirkungen klimapoliti-scher Maßnahmen auf die Struktur der Stromnachfrage analysieren zu können.
Aktualisiert: 2022-10-06
> findR *
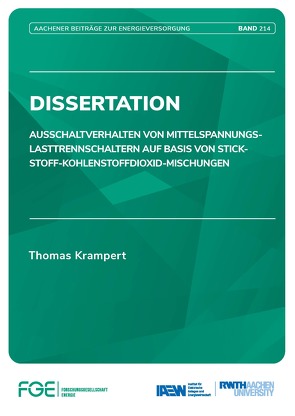
In der Mittelspannungsebene sind Lasttrennschalter die in Deutschland meist verbauten Schaltgeräte und stellen somit einen wichtigen Baustein der elektrischen Energieversorgung dar. Aufgrund der gestellten Anforderung an eine kompakte Baugröße ist ein wachsender Anteil in gasisolierten Schaltanlagen verbaut. Das dafür verwendete Gas Schwefelhexaflu-orid ist mit einem Treibhauspotential von 23 500 CO2-Masseäquivalenten das stärkste bekannte Treibhausgas, weshalb eine Substitution angestrebt wird. Da die dafür in Frage kommenden Gase jedoch eine geringere Leistungsfähigkeit
aufweisen, ist eine Anpassung der Schalterkonstruktion notwendig. Die ausschlaggebenden Größen für eine erfolgreiche Stromunterbrechung sind dabei die Lichtbogenkühlung durch eine axiale Beblasung und der Hartgaseffekt. Für die optimale Auslegung eines Mittelspannungs-Lasttrennschalters ist jedoch ein tiefergehendes Verständnis aller relevanter Einflussfaktoren notwendig.
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Einflusses der Schalterkonstruktion sowie der Strom- und Spannungsbelastung auf das Ausschaltverhalten eines umweltfreundlicheren Mittelspannungs-Lasttrennschalters auf Basis von Stickstoff-Kohlenstoffdioxid-Mischungen. Für die Untersuchungen wird für einen Modellschalter das thermische Ausschaltvermögen, die dielektrische Wiederverfestigung sowie das Stromabrissverhalten für verschiedene Auslegungsvarianten bestimmt. Aus den Untersuchungen werden Auslegungskriterien abgeleitet und zum Aufbau eines Technologie-Demonstrators genutzt. Anhand der normgerechten Prüfung des Ausschaltvermögens des Technologie-Demonstrators erfolgt der Nachweis der Gültigkeit der Auslegungskriterien.
Aktualisiert: 2022-01-31
> findR *
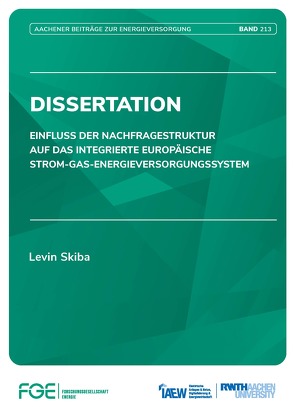
Die internationalen und europäischen Klimaschutzziele sehen eine Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs durch den Klimawandel auf höchstens 1,5- 2 °C vor. Dies erfordert unter anderem eine umfassende Reduktion von Netto-Treib-hausgasemissionen, insbesondere von CO2-Emissionen, in allen Bereichen des europäischen Energiesystems. Entspre-chend müssen zunehmend klimaneutrale Energieträger genutzt werden, wozu umfangreiche Anpassungen auf der Verbraucher- und auf der Versorgungsseite des Energiesystems notwendig sind. Dabei ist jedoch unklar, wie sich die Nachfragestruktur, also die Höhe und Zusammensetzung der Nachfrage nach Endenergieträgern auf der Verbraucherseite, zukünftig entwickeln wird. Darüber hinaus ist unklar, welche Entwicklung des Energieversorgungssystems (EVS) notwendig ist, um die Deckung dieser Nachfrage sowie des resultierenden Flexibilitätsbedarfs sicherzustellen. Neben der Bereit-stellung von Strom aus regenerativen Quellen ist dabei aufgrund fortschreitender Sektorenkopplung zunehmend auch die Bereitstellung klimaneutraler Gase und Flüssigkraftstoffe zu berücksichtigen. Damit ist fraglich, in welchem Umfang
Erzeugungsanlagen von Strom, synthetischen Gasen und Flüssigkraftstoffen sowie entsprechende Speicher- und Übertragungsanlagen im zukünftigen europäischen EVS zur Deckung der Nachfrage nach Endenergieträgern und Flexibilität benötigt werden und in welchem Maß Energieträger zukünftig von außerhalb Europas importiert werden.
Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wird in der vorliegenden Arbeit ein mathematisches Modell zur Optimierung von Zubau-, Abbau- und Einsatzentscheidungen im integrierten europäischen Strom-Gas-EVS in Abhängigkeit einer vorzugebenden Nachfragestruktur entwickelt. Das resultierende lineare Optimierungsproblem basiert auf einer Minimierung der Gesamtkosten des betrachteten EVS zur Deckung der vorgegebenen Nachfrage nach Strom, Wasserstoff, Methan und Flüssigkraftstoffen unter Berücksichtigung wesentlicher technischer und wirtschaftlicher Restriktionen. Dabei werden Investitions- und Einsatzentscheidungen für Anlagen zur Strom-, Gas- und Flüssigkraftstofferzeugung sowie Speicher- und Übertragungsanlagen der Energieträger Strom, Wasserstoff und Methan bestimmt. Der Betrachtungszeitraum umfasst die Jahre 2020 bis 2050 mit einer stündlichen Auflösung betrachteter Stützjahre.
In exemplarischen Untersuchungen wird das entwickelte Verfahren unter Annahme unterschiedlicher zu bedienender Nachfragestrukturen angewendet. In allen untersuchten Szenarien werden in ganz Europa hohe Kapazitäten von Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien (EE-Anlagen) zugebaut. Besonders ausgeprägt ist
dieser Zubau im Szenario mit hoher Elektrizitätsnachfrage, wodurch sich zusätzlich hohe Kapazitäten von Flexibilitätsoptionen wie flexiblen Kraftwerken, Speichern oder Erzeugungsanlagen für synthetische Gase und Flüssigkraftstoffe ergeben. In Szenarien mit hoher Wasserstoff- oder Methannachfrage fallen diese Kapazitäten deutlich geringer aus. Weitere Untersuchungen unterstreichen den hohen Einfluss angenommener Kosten für den Import klimaneutraler Energieträger auf die installierten Kapazitäten von EE-Anlagen und Flexibilitätsoptionen sowie auf die importierten Mengen dieser Energieträger.
Aktualisiert: 2022-06-16
> findR *
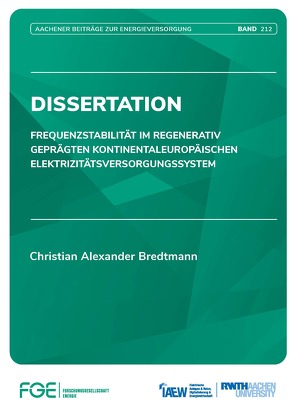
Durch den Zubau von Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien befinden sich zukünftig vermehrt
umrichterbasierte Anlagen im kontinentaleuropäischen Elektrizitätsversorgungssystem. Ein Großteil dieser Anlagen liefert keinen intrinsischen Beitrag zur Frequenzstützung, da keine elektromechanische Kopplung mit dem elektrischen Netz vorliegt. Darüber hinaus werden weiterhin Stilllegungen von Großkraftwerken prognostiziert, so dass der Anteil elektromechanisch mit dem Netz gekoppelter Erzeugungsanlagen sinkt. Dies führt insgesamt zu einer Reduktion rotierender Massen und somit zu einer Verminderung stabilisierender Einflüsse auf die Netzfrequenz. Daher ist eine Untersuchung einer potentiellen Gefährdung der Frequenzstabilität notwendig, bei der auch geprüft wird, inwiefern
umrichterbasierte Anlagen mit entsprechender Regelung zukünftig einen unterstützenden Einfluss auf die Netzfrequenz haben können.
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, eine Quantifizierung dieser Auswirkungen in einem erneuerbar geprägten kontinentaleuropäischen Synchrongebiet zu ermöglichen, so dass ein Verfahren zur Zeitbereichssimulation mit adäquaten dynamischen Modellen entwickelt wurde.
Das entwickelte Verfahren und die Modelle ermöglichen, die gegebenen regionalen Unterschiede in derErzeugungsstruktur und die Standortabhängigkeit der Netzfrequenz mithilfe eines hochaufgelösten Mehr-Knoten-Netzmodells zu
berücksichtigen, um auch Fragen hinsichtlich regionaler Kernanteile für die Momentanreserve und Primärregelung zu beantworten. Die Komponentenmodelle und angewendeten Methoden sind speziell hinsichtlich ihrer Eignung für Frequenzstabilitätsuntersuchungen und mit Fokus auf Windenergie-, Photovoltaik- und Energiespeicheranlagen mit einer parametrierbaren Frequenzstützung analysiert, angepasst und weiterentwickelt worden. Der dabei gefundene Kompromiss zwischen ausreichender Genauigkeit und Modellreduktion ist gelungen, so dass das ausgedehnte Netz des kontinentaleuropäischen Synchrongebiets mit dem entwickelten Verfahren in annähernd Echtzeit simulierbar ist.
Die exemplarischen Untersuchungen eines Szenarios des Jahres 2050 mit einem Anteil an der Leistungseinspeisung von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien von etwa 58% in Europa und etwa 89% in Deutschland zeigen, dass die Kennwerte für die Frequenzstabilität auch ohne Frequenzstützung aus umrichterbasierten Anlagen innerhalb der aktuell
gültigen Grenzwerte liegen, so dass für das untersuchte Szenario keine Gefährdung der Frequenzstabilität vorliegt. Darüber hinaus sind umrichterbasierte Anlagen in der Lage, sowohl Leistung aus einer RoCoF-Regelung als auch Primärregelleistung bereitzustellen und zeigen in den Untersuchungen entsprechende stabilisierende Effekte. Dabei ist eine reine Proportionalregelung nicht imstande, die transient auftretenden Frequenzgradienten signifikant zu minimieren. Dies konnte durch eine PD-Regelung erreicht werden. Weitere Untersuchungen zur Standortabhängigkeit der Momentanreserve zeigen, dass ein signifikanter lokaler Einfluss auf die maximalen Frequenzgradienten in der Umgebung der frequenzstützenden Anlagen vorliegt. Die maximal auftretenden Frequenzgradienten im Synchrongebiet konnten hierbei nicht reduziert werden. Eine RoCoF-Regelung kann jedoch dazu dienen, Frequenzgradienten in Regionen mit geringer Momentanreserve zu dämpfen.
Aktualisiert: 2022-02-24
> findR *
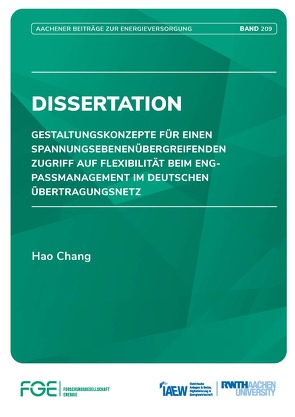
Das Voranschreiten der Energiewende führt zu einem stetig steigenden Ausbau von Erzeugungsanlagen auf Basis von Er-neuerbaren Energien in Deutschland. Zusammen mit der wachsenden Anforderung nach Sektorenkopplung und der Elekt-rizierung von Endanwendungen in den fossil dominierten Bereichen bedingen diese Transformationsprozesse weitreichen-de Veränderungen von Stromerzeugung und -verbrauch.
Zur Gewährleistung der Netzsicherheit im deutschen Übertragungsnetz spielt das betriebliche Engpassmanagement bereits heute eine maßgebliche Rolle. Die Flexibilitätsbereitstellung zur Wirk- und Blindleistungsanpassung für die Engpassbehe-bung wird dabei vornehmlich durch konventionelle Kraftwerke im Übertragungsnetz erbracht. Zukünftig ist es jedoch abseh-bar, dass ein Großteil der verfügbaren Flexibilitätsoptionen, insbesondere die neuartigen Stromanwendungen, auf der Ver-teilnetzebene angesiedelt sein wird. Es stellt sich folglich die Frage, wie der Flexibilitätszugriff der Übertragungsnetzbetrei-ber zukünftig mit den unterlagerten Verteilnetzbetreibern koordiniert werden soll.
Im Rahmen dieser Dissertation werden daher verschiedene fundamentale Gestaltungskonzepte hinsichtlich der netzbe-trieblichen Koordination für das operative Engpassmanagement gegeneinander bewertet.
Die exemplarischen Untersuchungen zeigen, dass insbesondere die Konzepte sich eignen, die eine Realisierung von Synergieeffekten zwischen den Spannungsebenen ermöglichen und somit zu einer Reduktion der notwendigen Eingriffen der einzelnen Netzbetreiber beitragen können.
Aktualisiert: 2022-01-13
> findR *
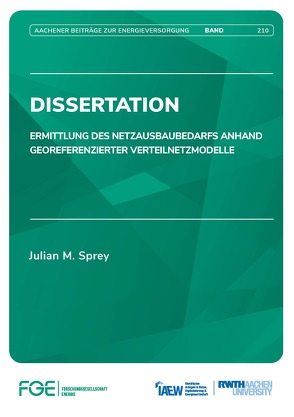
Der Ausbau von Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien sowie der erwartete Anschluss von Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge verändert die Versorgungsaufgabe in den Verteilnetzen. In vielen Netzen führen diese Entwicklungen zu einem Netzausbaubedarf. Umfang und die Heterogenität der Mittel- und Niederspannungsnetze (MS- und NS-Netze) sowie eine geringe Verfügbarkeit von Netzdaten erschweren Betrachtungen aller ca. 4.500 MS-Netze und ca. 500.000 NS-Netze in Deutschland. Energiewirtschaftliche Fragestellungen, wie die Frage nach dem erwarteten Netzausbaubedarf, werden bisher nur für wenige exemplarische Netze durchgeführt, die als Einzelergebnisse zur Hochrechnung genutzt werden.
Mit steigender Verfügbarkeit öffentlich zugänglicher georeferenzierter Daten stellt sich daher die Frage, ob das Netzmengengerüst der MS- und NS-Netze deutschlandweit vollständig und realitätsnah abgebildet und damit der deutsche Netzausbaubedarf bestimmt werden kann. Das Ziel dieses Forschungsvorhabens war daher die Entwicklung einer Methode zur Generierung georeferenzierter MS- und NS-Netze für Deutschland, auf deren Basis der Netzausbaubedarf bestimmt und bewertet werden kann.
Erster wissenschaftlicher Beitrag der Dissertation ist die entwickelte Methode, die öffentlich zugängliche Datensätze, wie Daten des OpenStreetMap-Projektes, des Zensus 2011 und der Anlagenstammdaten von Erzeugungsanlagen, zu einem gebäude- und anlagenscharfen Modell der heutigen Versorgungaufgabe zusammenführt und die Netzstruktur dann unter Verwendung von Straßenverläufen und unter Berücksichtigung von Grundsätzen zu Planung und Betrieb der Netze ermittelt. Zur Abgrenzung von Netzgebieten kommen hierbei Clusteralgorithmen zum Einsatz. Ringnetzstrukturen der MS-Netze werden über ein Capacitated-Vehicle-Routing-Problem, Strahlennetzstrukturen der NS-Netze über ein Capacitated-Minimum-Spanning-Tree-Problem abgeleitet.
Die exemplarische Anwendung der entwickelten Methode zeigt in einem Vergleich mit veröffentlichten Netzstrukturmerkmalen der MS- und NS-Ebene, dass sie unter Verwendung öff entlich zugänglicher Datensätze das heutige Netzmengengerüst in ausreichender Genauigkeit abbilden kann. Mit dem so erzeugten, georeferenzierten Netzdatensatz der MS- und NS-Netze kann anhand verschiedener Netzstrukturkennzahlen hinsichtlich Netzlänge, Netzkunden- und Lastdichte erstmals die Heterogenität sämtlicher MS- und NS-Netze dargestellt werden. Die Ergebnisse zeigen die erwartungsgemäßen Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Netzen, doch auch innerhalb von städtischen und ländlichen Regionen sind die Netze sehr heterogen.
Zweiter wissenschaftlicher Beitrag der Dissertation ist die Bestimmung des Netzausbaubedarfs der gesamten MS- und NS-Netze in Deutschland erstmals auf Grundlage eines deutschlandweiten vollständigen Netzmodells. Die Untersuchung des Netzausbaubedarfs zeigt für vorgegebene Szenarien der zukünftigen Versorgungsaufgabe erwartungsgemäß, dass in ländlichen Regionen der Zubau von Windenergie- und Photovoltaikanlagen weiterhin der wesentliche Treiber des Netzausbaus ist und sich in städtisch geprägten Regionen ein Zuwachs von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf den Netzausbaubedarf auswirken kann. Jedoch zeigen sich auch innerhalb von ländlichen oder städtischen Regionen starke Unterschiede je spezifischem Netz, die durch die bisher übliche Betrachtung repräsentativer Netze nicht adäquat abgebildet werden können.
Aktualisiert: 2021-10-28
> findR *
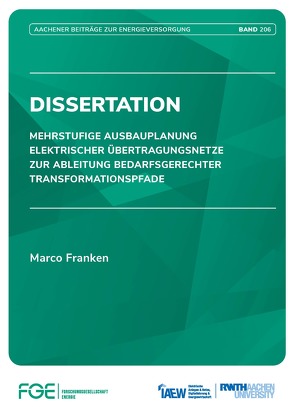
Durch die politisch forcierte Dekarbonisierung des Energieversorgungssystems und dem damit verbundenen zumeist lastfernen Ausbau erneuerbarer Energien nimmt der Transport elektrischer Energie und somit der Bedarf nach neuen Übertragungskapazitäten signifikant zu. Aufgrund zeitintensiver Genehmigungsverfahren und einer fehlenden
gesellschaftlichen Akzeptanz von Netzausbauprojekten ist den steigenden Transportanforderungen daher durch bedarfsgerechte Maßnahmen wie die Verstärkung und Optimierung der bestehenden Netzstruktur oder den Einsatz netzbetrieblicher Freiheitsgrade nachzukommen. Zugleich bedingt die Transformation des Energieversorgungssystems sich stetig wandelnde Anforderungen an das elektrische Übertragungsnetz, die durch die Analyse zeitlich gestaffelter Stützjahre erfasst werden können. Infolge einer vorausschauenden Planung kann der Bedarf an neuen Übertragungskapazitäten nachfolgender Stützjahre bereits frühzeitig antizipiert und somit zur Identifikation geeigneter mehrstufiger Transfor-mationspfade berücksichtigt werden.
In dieser Forschungsarbeit wird ein Verfahren zur mehrstufigen Ausbauplanung elektrischer Übertragungsnetze entwickelt, das die Ableitung bedarfsgerechter Transformationspfade erlaubt. Durch die integrierte und zugleich zeitlich voraus-schauende Optimierung von Netzplanung und Netzbetrieb erfolgt die Abbildung der Interdependenzen zwischen zeitlich gestaffelten Stützjahren sowie zwischen netzplanerischen Maßnahmen und netzbetrieblichen Freiheitsgraden. Das entwickelte Verfahren zielt auf die Minimierung der erforderlichen Investitions- und Betriebskosten unter Einhaltung des (n-1)-Kriteriums ab. Das Technologieportfolio umfasst neben der detaillierten Abbildung von Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen der Drehstromtechnik die Installation leistungsflusssteuernder Komponenten wie Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Systeme, Phasenschiebertransformatoren und thyristorgesteuerten Serienkompen-sationsanlagen. Durch die Einbindung von Engpassmanagementmaßnahmen wie beispielsweise Redispatch konventioneller Kraftwerke wird eine Optimierung des Netzbetriebs ermöglicht.
Im Rahmen exemplarischer Untersuchungen werden die zur Auslegung bedarfsgerechter Transformationspfade zu berücksichtigenden Interdependenzen analysiert. Die Bedeutung einer zeitlich vorausschauenden Planung wird durch den Vergleich eines mehrstufigen mit einem sequentiellen Planungsansatz verdeutlicht. Die Untersuchung des vollständigen Technologieportfolios erlaubt im Vergleich zu einem limitierten Portfolio eine signifikante Reduktion der stützjahr-übergreifenden Investitions- und Betriebskosten. Der methodische Vergleich zwischen dem entwickelten und einem anerkannten heuristischen Verfahren unterstreicht die Bedeutung einer vollständig integrierten Optimierung von Netzplanung und Netzbetrieb.
Aktualisiert: 2021-08-12
> findR *
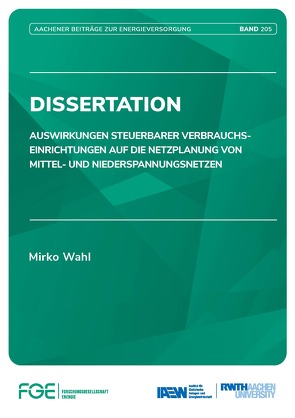
Zur Erreichung klimapolitischer Ziele wird eine Dekarbonisierung des Stromerzeugungssektors durch einen Zubau von Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien (EE-Anlagen) angestrebt. In den Mittel- und Niederspannungsnetzen (MS- und NS-Netzen) führte dies in den letzten Jahren zu einer veränderten Netznutzung und somit zu einem Netzausbau-bedarf. Die klimapolitischen Ziele sind durch eine Dekarbonisierung des Stromerzeugungssektors jedoch nicht zu errei-chen, so dass die Dekarbonisierung auf die Sektoren Mobilität und Wärme auszuweiten ist. Durch neuartige Verbrauchs-einrichtungen wie Elektrofahrzeuge (EV) und Wärmepumpen (WP) können hierbei Technologien auf Basis fossiler Ener-gieträger ersetzt werden. Die Netznutzung von MS- und NS-Netzen wird daher zukünftig einerseits durch einen anhaltenden Zubau von EE-Anlagen, die zunehmend in Kombination mit einem Batteriespeicher installiert werden, und andererseits durch eine steigende Anzahl von EV und WP beeinfl usst werden. Durch § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes ist es Verteilnetzbetreibern gestattet, die Flexibilität steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, wie EV und WP, in den NS-Netzen netzdienlich einzusetzen. In der Netzplanung ist daher zunehmend zwischen einem konventionellen Netzausbau und einem netzdienlichen Flexibilitätseinsatz abzuwägen.
Das Ziel des Forschungsvorhabens ist daher, ein Verfahren zu entwickeln, welches die Auswirkungen eines netzdienlichen Flexibilitätseinsatzes auf den Netzausbaubedarf in MS- und NS-Netzen unter Berücksichtigung einer unsicheren Entwick-lung der Netznutzung untersucht. Kern des Netzplanungsverfahrens ist dabei die Simulation eines aktiven Netzbetriebs, welche betriebliche Maßnahmen zur Spannungshaltung und zur temporären thermischen Entlastung der Betriebsmittel bestimmt. Durch einen optimalen Lastfluss werden die Stufung von regelbaren Ortsnetztransformatoren sowie der Flexi-bilitätseinsatz von Verbrauchseinrichtungen, EE-Anlagen und Batteriespeichern unter Berücksichtigung von zeitkoppelnden Nebenbedingungen ermittelt.
Das entwickelte Verfahren wird in exemplarischen Untersuchungen auf verschiedene Versorgungsaufgaben angewendet. Hierbei ist ein Netzausbaubedarf durch Verbrauchseinrichtungen insbesondere in (vor-)städtischen Netzen zu identifizieren.
Ein netzdienlicher Flexibilitätseinsatz kann diesem Netzausbau entgegenwirken und somit zu einer Kostenreduktion in der Netzplanung führen. Im untersuchten ländlichen Netzgebiet wird durch einen Flexibilitätseinsatz von Verbrauchseinrich-tungen und Batteriespeichern die Abregelung von EE-Anlagen reduziert und somit die Integration von EE-Anlagen ver-bessert. Da ein Flexibilitätseinsatz zur Verzögerung von konventionellem Netzausbau führen kann, bietet dieser auch Vorteile bei zunehmenden Unsicherheiten in der Entwicklung der Netznutzung.
Aktualisiert: 2021-10-07
> findR *

Der fortschreitende Zubau regenerativer Erzeugungsanlagen in Verbindung mit der Elektrifizierung im Verkehrs- und Wärmesektor begründet einen steigenden Flexibilitätsbedarf im Stromsystem, um die Versorgung der Endkunden mit elektrischer Energie jederzeit zu gewährleisten. Während die Bereitstellung von Flexibilität bislang durch thermische und hydraulische Großkraftwerke erfolgte, wird für diese zentralen Flexibilitätsoptionen eine rückläufige Entwicklung in Zukunft erwartet. Gleichzeitig wird eine steigende Durchdringung der Verteilnetzebene mit dezentralen steuerbaren Anlagen auf Erzeugungs- und Nachfrageseite beobachtet. Vor diesem Hintergrund wird die aktive Nutzung dezentraler Flexibilität vermehrt diskutiert.
Um die Wirkung dezentraler Flexibilitätsoptionen auf das Stromsystem zu quantifizieren, werden Strommarktsimulationen angewendet, welche die Interaktionen zwischen Erzeugern und Verbrauchern im Strommarkt nachbilden. Herkömmliche Ansätze fokussieren häufig die detaillierte Abbildung zentraler Flexibilitätsoptionen, während dezentrale Flexibilitätsoptionen in nur aggregierter Form berücksichtigt werden. Damit stellt sich die Frage, inwieweit eine anlagenscharfe Betrachtung der dezentralen Flexibilitätsoptionen zu einer besseren Modellierung führt.
Ziel der Arbeit ist es daher, ein Strommarktsimulationsverfahren zu entwickeln, welches die dezentralen Flexibilitätsoptionen anlagenscharf abbildet und die Wechselwirkungen mit dem zentralen Erzeugungssystem geeignet berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird der herkömmliche Aggregationsansatz mit einer nachgelagerten Disaggregation kombiniert. Dabei wird ein aggregiertes Marktergebnis auf eine Vielzahl dezentraler Anlagen aufgeteilt, sodass anlagenscharfe technische Restriktionen eingehalten werden können.
Durch den Vergleich einer anlagenscharfen und aggregierten Modellierung wird gezeigt, dass die aggregierte Betrachtung zu einer Überschätzung des dezentralen Flexibilitätspotenzials in Höhe von rund 2-5 % führt. Dabei ist ihr Einfluss auf die jährlichen Stromerzeugungskosten und Energiemengen moderat. Als ein Mehrwert der anlagenscharfen Abbildung erweist sich die Ermittlung der Interaktionen zwischen den verschiedenen dezentralen Flexibilitätsoptionen.
Abschließend wird das entwickelte Verfahren exemplarisch auf ein Zukunftsszenario 2035 angewendet, um die Wirkung einer flexiblen und unflexiblen Betriebsweise dezentraler Flexibilitätsoptionen auf die Strommärkte zu quantifizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Flexibilisierung von Elektrofahrzeugen und Photovoltaik-Heimspeichern die größte Wirkung auf die Strommärkte entfaltet.
Aktualisiert: 2021-09-30
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema ABEV
Sie suchen ein Buch über ABEV? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema ABEV. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema ABEV im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema ABEV einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
ABEV - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema ABEV, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter ABEV und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.