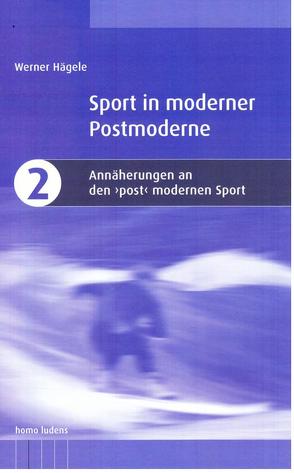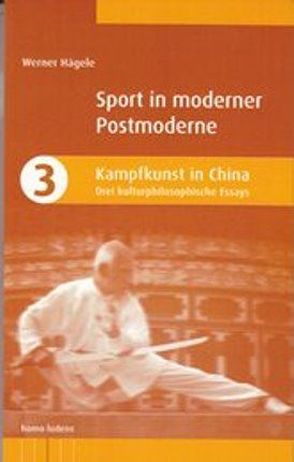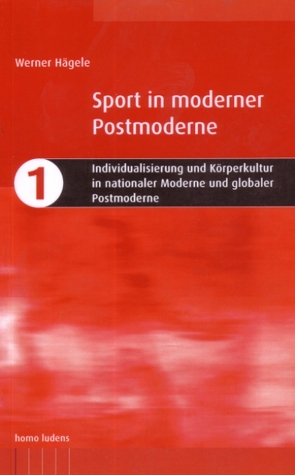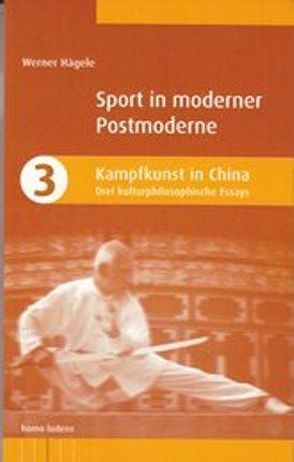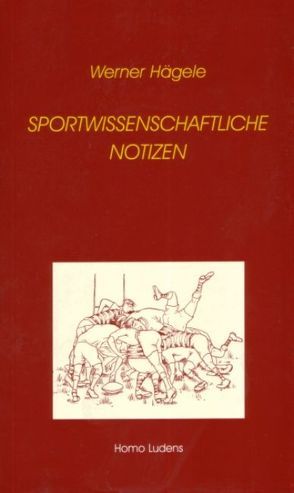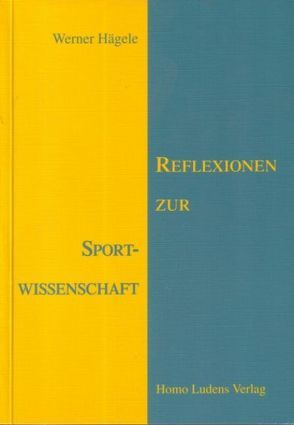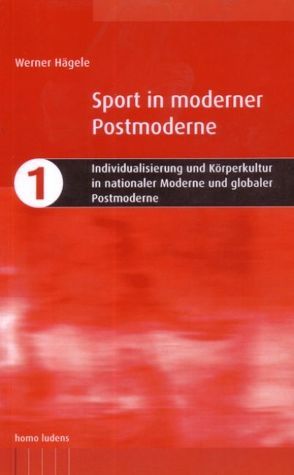Die Aufsatzsammlung “Annäherungen an den ›post‹modernen Sport” greift mit wechselnden Themenstellungen die strukturellen Veränderungen auf, die seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einer nachhaltigen Transformation des traditionellen Erscheinungsbildes von Gesellschaft und Sport geführt haben.
Bei aller Differenz weisen die vier Beiträge dennoch – wenn auch unterschiedlich gewichtet – inhaltliche wie formale Gemeinsamkeiten auf. Beitragsübergreifend konzipiert sind sowohl die enge Verzahnung und wechselseitige Abhängigkeit von gesellschaftlicher und sportlicher Entwicklung als auch von modernem und postmodernem Sport. Ferner steht nicht die destruktive Postmoderne mit ihren Schattenseiten im Fokus des Erkenntnisinteresses, sondern ihre anspruchsvolle Variante, die – zumindest implizit – die Frage aufwirft, welche Vorgaben an den Sport der Zukunft zu richten sind, um mehr Hoffnungen als Ängste bei den Menschen zu wecken.
Insbesondere wird der Versuch unternommen, das vielschichtige Theorien-Konstrukt der Postmoderne, welches in den 1980er Jahren durch die französische Philosophie nachhaltig geprägt wurde, auf den Gegenstandsbereich des Sports zu übertragen. In Deutschland wurde die gehaltvolle französische Variante des Postmodernismus lange Zeit entweder ignoriert, heftig kritisiert oder fand, wenn überhaupt, verzerrt Beachtung (vgl. Deleuze, 1993, S. 144). Die (später revidierte) Kritik von Habermas (1988) verdeutlicht dies anschaulich, der befürchtete, dass das Projekt der Moderne durch die tendenziell anti- und prämoderne Theorieausrichtung des Postmodernismus (in der Tradition von Nietzsche und Wittgenstein) ernsthaft gefährdet sei. Im Gegenzug warfen viele Postmodernisten ihren (modernistischen) Kritikern vor, sie würden ihre Texte voreingenommen und ohne die erforderliche Sorgfaltspflicht lesen, was die unverhältnismäßige Häufung von Fehldeutungen erkläre (vgl. Reijen & Veerman, 1989, S. 126).
Der anhaltende Disput zwischen Modernisten und Postmodernisten hat mittlerweile nicht nur viele Vorurteile abgebaut, sondern auch zur Klärung und Weiterentwicklung der Grundpositionen des Postmodernismus geführt, ohne allerdings die generelle Reserviertheit der Kontrahenten zu beseitigen. In der Sportwissenschaft trug der lange Zeit prekäre Status des französischen Postmodernismus mit dazu bei, dass dessen Erkenntnispotenzial, abgesehen von wenigen Ausnahmen, kaum wahrgenommen wurde. Dieses Defizit zu beseitigen und Verständnis für eine der innovativsten geistigen Herausforderungen der letzten Jahrzehnte zu wecken, war nicht zuletzt ein grundlegendes Anliegen in allen vier Beiträgen.
Im ersten Beitrag “Reflexionen zur Postmoderne und das Schweigen der Sportwissenschaft” rückt die Verständnisfrage ins Zentrum der Ausführungen. Auf der Basis des Erkenntnisgehalts so unterschiedlicher Autoren wie Lyotard, Derrida und Baudrillard wird versucht, den Begriff einer anspruchsvollen Postmoderne zu definieren. Zu dessen herausragenden Merkmalen können insbesondere die fortschreitende Pluralisierung, Ästhetisierung und Medialisierung der gegenwärtig sich konstituierenden Informationsgesellschaft gezählt werden.
Um idealisierte Übergeneralisierungen zu vermeiden, dürfen jedoch die den Begriffskern umlagernden dysfunktional-destruktiven Strukturmerkmale der eklektischen Indifferenz, des narzisstischen Ästhetizismus sowie der krebsartig wuchernden Hyperrealisierung nicht außer Acht gelassen werden. Auf diese Merkmale berufen sich insbesondere jene Kritiker des Postmodernismus, die im Extrem dazu tendieren, “posthistoiresche” Katastrophen- und Endzeit-Szenarien zu entwerfen, wie dies Baudrillards Œuvre eindrucksvoll bekundet.
In der Anwendung des postmodernen Theoriedesigns auf das materiale Feld des Sports zeigt sich, dass die herkömmlichen Denkmodelle in der Sportwissenschaft zur Überfavorisierung von Integration und Holismus neigen. Hingegen werden Themenstellungen wie Patchwork-Identität, Paralogie oder widerstreitende Gerechtigkeit weitgehend ausgegrenzt. Offenkundig wird, dass ein epochaler Gesellschaftsumbruch mit den Mitteln der Klassiker-Exegese nur unzureichend erschlossen werden kann. Das verstärkte Nachdenken über adäquate Theorie-Modelle ist unverzichtbar.
Die Sozialphilosophie der Postmoderne liefert in dieser Hinsicht eine Fülle wertvoller Anregungen. Ihre Stärken liegen in der kritischen Hinterfragung sakrosankter Wahrheiten und ihrem resoluten Eintreten für mehr Freiheit, Glück und Selbstverwirklichung der Menschen. Ihre Schwächen offenbaren sich in ihrem Hang zur Polarisierung und krassen Überfavorisierung von Differenz, Dissens und Kultur bei gleichzeitiger Vernachlässigung, gar Ausklammerung von Einheit, Konsens und Natur in ihrem Theoriedesign.
Im zweiten Beitrag “Soziale Differenzierung, Individualität und Sport” wird die Individualisierungsthese zum sozialen Differenzierungstheorem in Beziehung gesetzt: Danach beruht die Individuation der Individuen primär auf der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Hierzu werden die Aussagen von G. Simmel herangezogen, der neben Durkheim zu den frühen Vertretern der Differenzierungstheorie zählt.
Für Simmel löste der epochale Wandel von der ständischen Agrargesellschaft zur modernen Industriegesellschaft im 19. Jahrhundert nicht nur eine fortschreitende Arbeitsteilung und gesellschaftliche Subsystembildung aus, sondern befreite die Individuen gleichzeitig aus der Enge stratifizierter Korporationen. Für Spiel und Leibesübungen zog dies die allmähliche Herauslösung aus Brauchtum und Kult der Feudalgesellschaft nach sich sowie deren schrittweise Institutionalisierung und Integration in den Turnverein bzw. deutschen Turnerbund. Zur Geltung kam hierbei eine kollektivistische Individualität, die sich stärker durch normative Rollenkonformität, Disziplin und Ordnung auswies als durch den Wunsch nach individueller Selbstverwirklichung. Erst die Ablösung des formalistisch-nationalistischen Turnsystems durch den olympischen Sport im 20. Jahrhundert mit seiner stärkeren Akzentuierung von individueller Leistung und Wettkampf relativierte das vorherrschende hierarchisch-normative Menschenbild grundlegend. Dennoch blieb im Vereinsleben in (West-) Deutschland bis in die Spätmoderne der 1960er Jahre ein vorwiegend altruistisch ausgerichteter Moralkodex verhaltensrelevant.
Erst die wachsende Kritik am überkommenen Traditionalismus in Gesellschaft und Sport löste einen grundlegenden Wertewandel aus. Dieser wurde vorangetrieben durch die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einsetzende Globalisierung, Medialisierung und Enträumlichung der gesellschaftlichen Strukturen. Dadurch wurden jene institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen, welche die reflexive Rollentheorie mit ihrem selbstbestimmten Menschenbild seit jeher forderte. Im Sport schlug sich diese Entwicklung nicht nur in einem erheblichen Größenwachstum nieder, sondern auch in einer nicht unproblematischen Entgrenzung seines durch Turnen (19. Jh.) und Olympismus (20. Jh.) geprägten Selbstverständnisses. Der Individualisierungsschub, den insbesondere die neuen Outdoor- und Trendsportarten auslösten, beförderte den Sportler viel nachdrücklicher zum reflexiven Gestalter seines Verhaltens als jemals zuvor. Ein Irrtum wäre es allerdings anzunehmen, der selbstbestimmte “Sporthopper” wäre weniger anfällig für fremdbestimmte Vermassung und kulturindustrielle Manipulation. Realiter dürfte stets ein Mixed aus beiden Komponenten vorliegen, jeweils abhängig vom sozialen Kontext sowie – nicht zuletzt – der Entscheidungskraft des Einzelnen.
Im dritten Beitrag “Nationalität, Weltgesellschaft und Sport” wird die Globalisierungsproblematik thematisiert. Kraft seiner Souveränität und sozialen Ordnungsfunktion oblag es dem Nationalstaat in der Moderne, den gesellschaftlichen Institutionen und korporativen Verbänden den notwendigen Halt und hinreichende Integration zu gewährleisten. Kosmopolitische Visionen wie Kants Völkerbunds-Konzeption erlangten erst Ende des 19. Jahrhunderts konkretere Gestalt, als die Renaissance transnationalen Gedankenguts zur Gründung einer Vielzahl von internationalen Beziehungen führte. Dies erklärt, warum sich im 19. Jahrhundert der philanthropische Kosmopolitismus von Guts Muths gegen die Gemeinschaftsideologie des Jahn’schen Turnens allenfalls bedingt behaupten konnte. Hinzu kommt, dass sich die Turnerschaft als Teil einer Nationalbewegung verstand, die ihr Selbstverständnis überwiegend aus der Treue zu Volk und Vaterland ableitete. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich der Internationalismus des Sports – gegen den anfänglich heftigen Widerstand der deutschen Turnerschaft – immer stärker durch und transportierte mit Coubertins Olympismus ein liberaleres, selbstbestimmteres Menschenbild, das allmählich die Oberhand gewann. Bis in die Spätmoderne der 1960er Jahre finden sich dennoch viele Spuren der nationalistischen Turnbewegung, wie etwa die hohe Wertschätzung der Deutschen für Nationalmannschaft und Ländervergleichswettkämpfe.
Eine weltweite, massenmediale Kommunikation konnte sich erst in der Postmoderne durchsetzen, als mit Handy, Computer und Internet die erforderliche Technologie zur Verfügung stand. Erst diese technologischen Errungenschaften ermöglichten die sprunghafte Zunahme globaler Sozialkontakte auf Kosten lokaler und nationaler Verbindungen. Verfechter einer transnationalen Weltgesellschaft beurteilen die gegenwärtigen Entnationalisierungstendenzen indessen nicht als strukturelle Auflösung, sondern als Neudefinition nationalstaatlicher Kompetenzen unter globalen Vorzeichen. Extrem monistischen Weltstaats-Entwürfen stellen sie das Glokalisations-Theorem gegenüber, das die unaufhebbare Dialektik von weltlicher Konvergenz und lokaler Differenz ausdrücklich bejaht.
Der Wachstumsschub, den der postmoderne Sport erfuhr, schlug sich zum einen in der Transnationalisierung seiner Verbände sowie der weltweiten medialen Präsenz seiner Großveranstaltungen (insbesondere der Olympischen Spiele) nieder. Zum anderen erlangte er innerhalb weniger Jahrzehnte den Status einer Weltkultur, deren Normen, Werte und Symbole über alle nationalen Grenzen hinweg von Milliarden Menschen geteilt werden. Gleichzeitig wuchs die Gefahr der Hegemonialisierung des Weltsports durch die Dominanz des westlich-agonalen Sportverständnisses. Auf lokaler Ebene des Sports wiederum wurde der Einfluss des Nationalismus durch die wachsende Bedeutung des professionellen Vereins- und Ligasports merklich zurückgedrängt, was sich an der zunehmend multikulturellen Rekrutierung der Spieler, Trainer und Manager unschwer ablesen lässt. Dennoch ist die Bedeutung von Nation und Nationalmannschaft bei sportlichen Großveranstaltungen nach wie vor ungebrochen. Höchst fragwürdig ist daher, ob und inwieweit der globale Weltsport künftig seine kosmopolitischen Visionen nachdrücklicher wird umsetzen können als in der Vergangenheit. Gegenwärtig scheint eher zuzutreffen, dass die seit seinen Anfängen viel beschworene humanitäre Leitidee der Würdigung der Person des Athleten über alle nationalen und sonstigen Gegensätze hinweg im Medaillen-Ranking der Nationen zu ersticken droht.
Im vierten und letzten Beitrag “Leichtathletik im Schulsport der Postmoderne” werden aus der Perspektive einer Sportart jene Probleme aufgegriffen, die der postmoderne Wertewandel in Schule und Schulsport ausgelöst hat. Dem Trend zur Profilierung und stärkeren Autonomisierung des Schulsystems konnte sich die Schulleichtathletik ebenso wenig entziehen wie dem Ruf nach stärkerer Akzentuierung von erziehendem Unterricht und wertebesetzter Bildung. Doch erst die nachlassende Beliebtheit und wachsende Konkurrenz durch die boomenden Trend- und Erlebnissportarten sowie die anhaltende Kritik an der traditionell einseitigen Hervorhebung von Wettkampf, objektiver Leistung und normierten Techniken bewirkten in den 1990er Jahren eine grundlegende Revision ihres Selbstverständnisses. Inwieweit die Öffnung der Schulleichtathletik für mehr Spiel, Vielfalt und Schülerorientierung jedoch tatsächlich eine hoffnungsvolle Zukunft verspricht, wird anhand gegenwärtiger Trends diskutiert. Und es werden Hypothesen formuliert, wie eine wünschenswerte Zukunft aussehen könnte.
Auch wenn die Schulleichtathletik in der Vergangenheit vorwiegend einem sportartimmanenten Erziehungsmodell verpflichtet war, muss sie künftig an der Institution Schule ihre unaufhebbare Interdependenz mit dem pädagogischen Erziehungs- und Bildungsauftrag stärker als bisher zur Kenntnis nehmen. Trotz Aufwertung von Spiel, Erlebnis und Kurzweil darf dies nicht zur Verteuflung von Leistung, Arbeitsmoral und Wetteifer führen, vielmehr kann sie durch die Bejahung eines intrinsisch motivierten Leistungsverständnisses ihren Teil zur Förderung einer positiven Leistungskultur in Schule und Schulsport beitragen. Die kritische Auseinandersetzung mit der glitzernden Show- und Medienwelt der “großen Leichtathletik” ist hierzu unerlässlich. Angesichts der krankmachenden Entkörperlichung unserer Kinder scheint die Förderung einer “kleinen Leichtathletik” immer dringlicher zu werden, die – im Verbund mit Turnen und Schwimmen – die elementare Grundmotorik des Laufens, Werfens und Springens vermittelt. Die Überwindung der einseitigen Leistungs- und Wettkampforientierung zugunsten der Mehrdimensionalität ihrer Strukturen ist daher keineswegs abwegig, sondern kann zumindest bedingt mithelfen, die körperlichen Defizite unserer Kinder zu kompensieren. Zwar läuft die unkontrollierte Bejahung von Pluralität und Vielfalt in der Postmoderne stets Gefahr, in Beliebigkeit und Indifferenz auszuarten. Sofern die Schulleichtathletik jedoch bereit ist, alle Neuerungen hinsichtlich ihrer Identitäts- und Systemverträglichkeit einer kritischen Überprüfung zu unterziehen, lässt sich eine systemgefährdende Diffusion durchaus vermeiden.
Trendsetter des neuen, poppigeren, bunteren und lockeren Sports sind nicht Schule und Sportverein, sondern der jugendliche Straßen- und Szenensport. Keineswegs abwegig ist daher die Überlegung, ob künftig nicht Versatzstücke des außerschulischen Szenensports in die Schulleichtathletik integriert werden sollten. Nicht “fit for fun” darf hierbei die oberste Maxime sein, sondern die produktive Balance von spontanem Spaßerlebnis und anspruchsvollem Üben und Trainieren. Hinzu kommt, dass weniger normative Sozialformen und Rollenbilder den Alltag des postmodernen Sports bestimmen, als vielmehr die individuelle Wahl- und Bastelmentalität seiner Protagonisten. Ohne einem grenzenlosen Liberalismus zu verfallen sollte die Schulleichtathletik daher mehr offene, spontane und reflexive Didaktikelemente in ihren Unterricht einfließen lassen. Nicht zuletzt bedürfen zukunftsweisende Schulkonzepte auch der tatkräftigen Mitwirkung durch die universitäre Leichtathletik, die ihr Selbstverständnis nicht länger nur aus einer theoriearmen Praxisausbildung, sondern verstärkt aus fachwissenschaftlichen Themenstellungen beziehen sollte.
Literatur
Deleuze, G. (1993): Unterhandlungen. 1972-1990. Frankfurt/M.
Habermas, J. (1988): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt. In: Welsch, W. (Hrsg.): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim, S. 177-192.
Reijen, W. van & Veerman, D. (1989): Die Aufklärung, das Erhabene, Philosophie, Ästhetik. Interview mit Jean-François Lyotard. In: Reese-Schäfer, W.: Lyotard zur Einführung. Hamburg, S. 111-159.