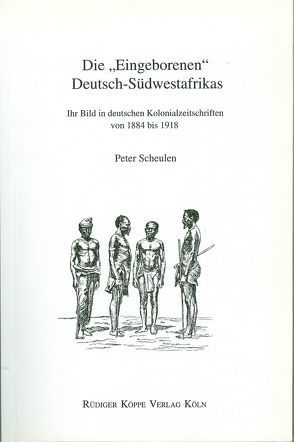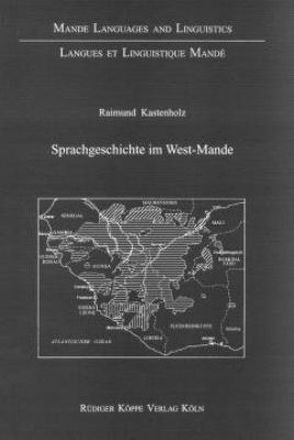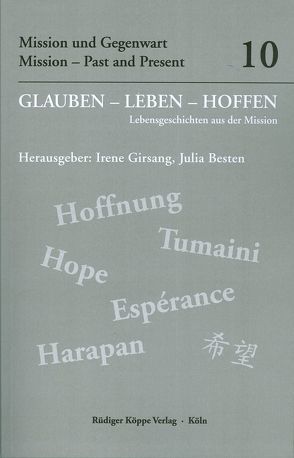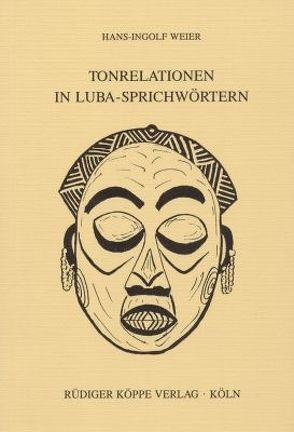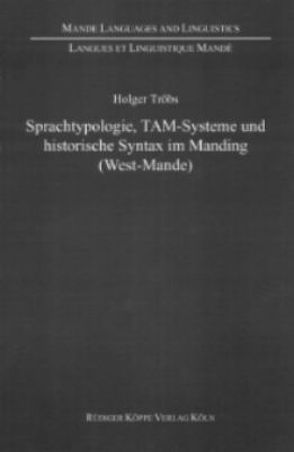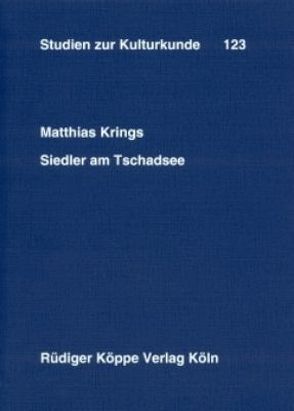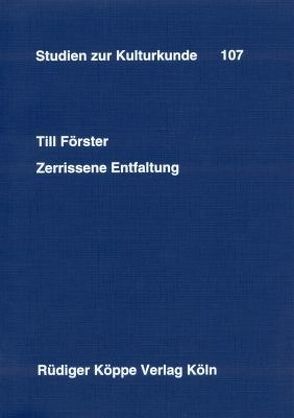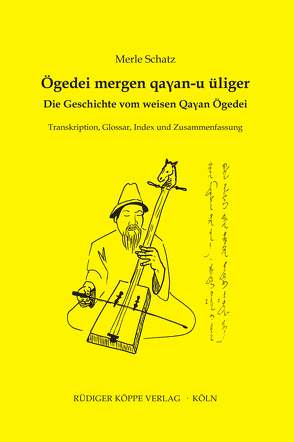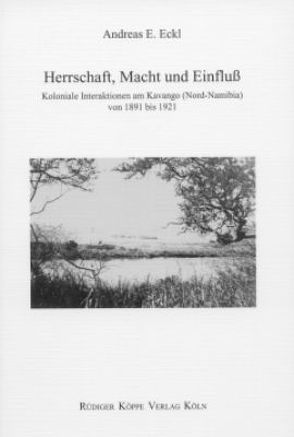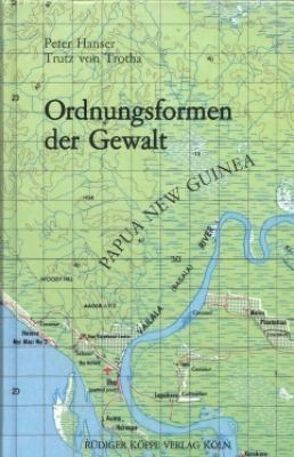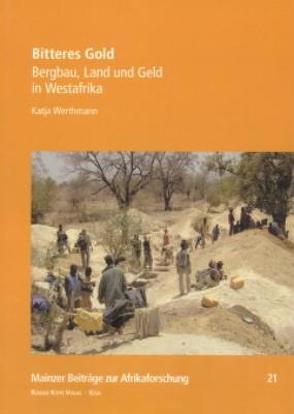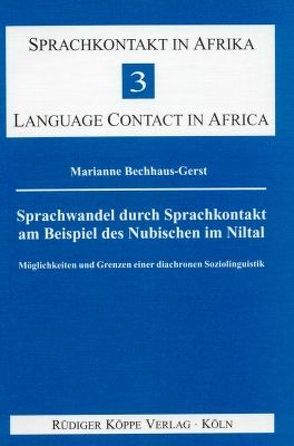Johannes Winkler wurde als sechstes von zwölf Kindern am 20. März 1874 in Uichteritz bei Weißenfels a.d. Saale geboren, wo sein Vater das Pfarramt innehatte. Nach anfänglichem Hausunterricht erhielt Johannes die weitere Schulausbildung in der Bürgerschule und am Gymnasium von Mühlhausen, das er 1893 mit dem Abitur abschloss.
Johannes Winklers Wunsch, Missionsarzt zu werden, reifte in den letzten beiden Schuljahren heran. Die Nähe zur Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) war ihm durch den Vater vertraut, der mit ihrem damaligen Direktor August Schreiber befreundet war, dessen Sohn Julius im Jahre 1900 das Missionshospital in Pearadja gründete. Im April 1893 begann Johannes Winkler das Medizinstudium in Halle, das er ab 1895 in Marburg/Lahn fortführte und im Jahre 1898 mit dem Staatsexamen abschloss. Im Anschluss daran bewarb er sich bei der RMG als Missionsarzt. Da in Deutschland eine Ausbildung zum Missionsarzt wegen fehlender Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, wurde Winkler von der RMG zur Fortbildung nach Edinburgh geschickt, wo schon 1841 eine ärztliche Missionsgesellschaft (EMMS Edinburgh Medical Missionary Society) gegründet worden war.
Nach einem Aufenthalt von dreieinhalb Monaten reiste er nach London, um am ersten Fortbildungskurs in Tropenmedizin an der neu eröffneten London „School of Tropical Medicine“ teilzunehmen. Die Deputation der RMG bestimmte Johannes Winkler am 12.2.1900 für die missionsärztliche Arbeit auf der Insel Nias (vor der Westküste Sumatras gelegen). Hierfür musste er jedoch zunächst das niederländische Arztdiplom erlangen, das er am 26.7.1901 an der Universität Utrecht ablegte. Im September 1901 wurde Johannes Winkler schließlich von der RMG als Missionsarzt nach Sumatra berufen und begann seine Arbeit am 15.1.1902 am neu gegründeten Hospital der großen Missionsstation in Pearadja auf der Hochebene des Silindung-Tales.
Für viele Ethnologen, vergleichende Religionswissenschaftler und Missionshistoriker ist Johannes Winklers Buch „Die Toba-Batak auf Sumatra in gesunden und kranken Tagen“ eine wahre Fundgrube über die traditionellen religiösen Vorstellungen und medizinischen Kenntnisse der Toba-Batak im Norden Sumatras. Seit vielen Jahrzehnten ist dieses Buch nur noch in Fachbibliotheken und vereinzelt in Antiquariaten zu finden. Mit dem vorliegenden Band hat die Herausgeberin, eine Enkelin Johannes Winklers, sein Werk nicht nur überarbeitet, ergänzt und mit bislang unveröffentlichten Passagen des Originalmanuskriptes angereichert, sondern zudem eine höchst informative Biographie ihres Großvaters und seiner Familie zusammengestellt, die viel Privates aus dem Leben des Missionsarztes berichtet. Im Anhang finden sich sowohl einige kürzere Texte, die Winkler für Fachzeitschriften geschrieben hat, als auch ein Verzeichnis all seiner publizierten Bücher und Artikel sowie der handschriftlichen Manuskripte, die sich noch im Nachlass befinden.
REZENSIONEN:
„Winklers Missionsstation Pearadja lag im Norden Sumatras, im Gebiet der Batak in der Nähe des Toba-Sees. Dort gewann er die Freundschaft des Heilkundigen Ama Batuholing. Dieser „Zauberdoktor“, wie Winkler ihn nannte, weihte den Missionsarzt in die Kunst ein, „Krankheiten im animistischen Sinne zu heilen“. Er erläuterte dem Deutschen „Schrift und Bedeutung der Zeichnungen in den Zauberbüchern“ und führte den Freund sogar in die Rituale für die vielen Orakel ein, nach denen sich Unglück oder Segen vorhersagen, „die Wünsche der Geistermächte“ interpretieren und mit Hilfe des Zauberkalenders günstige oder ungünstige Tage berechnen ließen. Winkler schrieb schließlich ein Buch über die Kultur der Toba-Batak, die ihn so sehr faszinierte.“
(dhe in „Schwäbisches Tagblatt“, 5.9.2007)
„[...] können wir dieses neuaufgelegte Buch ohne Weiteres als eine große Bereicherung der wissenschaftlichen Literatur zur Ethnologie, Geschichte und Religion der Batak in Nord-Sumatra (Indonesien) werten. Auch wenn heutzutage eine kritische Betrachtung und Reflexion der protestantischen ärztlichen Mission im damaligen Niederländisch Ost-Indien durchaus angebracht und notwendig ist, so muss das große kulturhistorische Verdienst dieses Dokumentes doch deutlich vor dem Hintergrund der regionalen und lokalen kolonialpolitischen und missionsideologischen Bedingungen in der ersten Hälfte des 20. Jhs. verstanden werden. Dass dieses Buch nichtsdestoweniger von Aktualität ist, zeigt die Tatsache, dass die eigenen Toba-Batak-Gelehrten Johannes Winklers Buch auch heute noch als eines der wichtigen Referenzwerke ihrer Kultur konsultieren.“
(Peter van Eeuwijk in „Anthropos“ 103, 2/2008, 616-617)
„Winklers Schriften sind eine wissenschaftliche Rarität. Schon allein die Tatsache, dass er über die Toba-Batak schrieb, ist aus heutiger Sicht etwas Besonderes, denn er war zu einer Zeit auf Sumatra, als die lokalen Ethnien starkem Veränderungsdruck ausgesetzt waren. Kontakt mit europäischen Missionaren zwang sie zu kulturellem Wandel, dessen Ausprägungen heute beobachtet werden können. Deshalb bietet Winklers Datensammlung einzigartiges Material für Vergleichsuntersuchungen. […] Winklers Vorgehen ist bis heute unter Medizinern selten, und war zu seiner Zeit selbst unter Ethnologen nicht weit verbreitet. […] Insgesamt ist die Veröffentlichung ein gut recherchiertes Zeitdokument, das Historikern, Regional- und Religionswissenschaftlern, wie auch Sozial-, Kultur- und Medizinethnologen wertvolles Datenmaterial zum Vergleich mit heute Beobachtbarem – nicht nur bei den Batak – bietet.“
(Susanne Rodemeier in „Curare“ 31/2+3, 2008, 248-250)
“This volume includes the new edition of Winkler’s book “Die Toba-Batak auf Sumatra in gesunden und kranken Tagen”, published in 1925, and other texts by Winkler, the missionary physician belonging to the Protestant mission of the “Rhenish Missionary Society”, as well as photographs owned by his family. The editors want to contribute to the present debate on western medicine and traditional healing because Western doctors encountered indigenous cultures in many forms, which resulted in (pre-conceived) generalizations about indigenous cultures about: “heathenism”, superstition, ineffective diagnosis and treatment, and quack medicine, added by the attitude of potential superiority of Christianity and western medicine. So, traditional healers were, in the first phase, frequently seen as phenomena of the “Antichrist”. In later years the accounts of indigenous culture became more qualified. Winkler’s other texts deal with midwifery, village life, Beriberi, the beginnings of medical mission, music of the Batak, the Batak script, the Usir game, the 6000-year calendar, and the book has maps, a list of Winkler’s publications, and a list of ethnographic artifacts.”
(Ulrich Oberdiek in „Anthropological Abstracts“, www-7/2008, 7074)